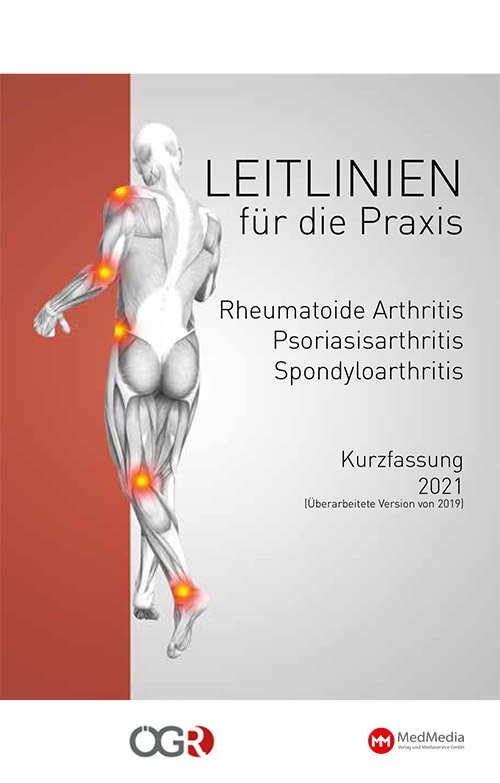Lupus erythematodes – deutliche Fortschritte mit viel Luft nach oben
SLE historisch
Lupus (lateinisch: „der Wolf“) wurde als Begriff bereits seit dem 12. Jahrhundert für eine große Vielzahl von unterschiedlichen Erkrankungen der Haut verwendet und soll vom lombardischen Chirurgen Frugardi eingeführt worden sein. Eine Erklärung für den Namen ist, dass die Narben, die nach dem Abheilen der Hautschäden verbleiben, den Narben von Wolfsbissen ähneln.1 Die Heterogenität in der Verwendung der Bezeichnung lässt sich daran ermessen, dass man auch heute noch die postprimäre Tuberkulose der Haut als „Lupus“ bezeichnet (Lupus vulgaris oder Tuberculosis cutis luposa).
Die erste historisch fassbare Beschreibung der Hauterscheinungen des Lupus erythematodes ist von Biett im Jahre 1833. Der heute gebräuchliche Name der Erkrankung wurde von Bietts Schüler Cazenave 1850 geprägt, der Wiener Dermatologe Ferdinand von Hebra beschrieb 1856 die Schmetterlingsgestalt des Lupus-Erythems. Sein Schwiegersohn und Nachfolger Moriz Kaposi (er beschrieb auch als erster das Kaposi-Sarkom) erfasste den lebensbedrohlichen Charakter des Lupus erythematodes auf Grund der systemischen Natur der Erkrankung mit Beteiligung innerer Organe und beschrieb 1869 und 1872 die wesentlichsten der allgemeinen und internistischen Manifestationen.2 Interessant dabei ist, dass die meisten der Observationen erst durch Post-mortem-Analysen erfolgten oder bestätigt werden konnten.
Die Ätiologie des SLE war lange Zeit rätselhaft, und die Wissenschaft konnte Kaposis Einschätzung von 1872 nicht widersprechen, wonach wir „nicht in der Lage sind, einige befriedigende Daten über die Ursache des Lupus erythematosus anzugeben“.
Der medizinisch wissenschaftliche Aufschwung ab der Mitte des 20. Jahrhunderts zeigte sich auch beim SLE. Hargraves entdeckte 1948 die LE-Zelle, womit die Beschreibung der immunologische Natur und Besonderheiten des SLE beginnt: Anti-Histon-Antikörper, die das LE-Zell-Phänomen auslösen, und Antikörper gegen andere Chromatinstrukturen wie doppelsträngige DNA (Anti-dsDNA-Ak); aber auch RNA-bindende Proteine (wie Ak gegen Sm, Ro, La, RA33) und Antikörper, die Zelloberflächenmoleküle erkennen und mit ihnen interagieren (Phospholipide, Erythrozyten, Thrombozyten), sind typisch für den SLE und seine Manifestationen.
Die ersten erfolgreichen Behandlungsstrategien für die renalen Manifestationen erfolgten mit systemischen Steroiden, nachdem diese für die chronische Polyarthritis als wirksam beschrieben wurden3, Pollak beschrieb 1961 die Bedeutung der ausreichenden Dosierung in der Lupusnephritis, schließlich war die Etablierung von Cyclophosphamid (CYC) in der Therapie der Lupusnephritis ein Meilenstein4, 5. Später kamen Therapeutika aus der Transplantatmedizin (Azathioprin, Mycophenolat-Mofetil [MMF]) als willkommene Ergänzung des therapeutischen Arsenals dazu.
An der Grenze vom Gestern zum Heute ist es erfreulich, zu lesen, dass die SLE-Mortalität im Jahr 2013 gegenüber 1968 deutlich gesunken ist, aber dieselbe Studie zeigt auch, dass es unvermindert eine Notwendigkeit zur Verbesserung der medizinischen Betreuung gibt, weil die SLE-Mortalität immer noch höher ist als die der Normalbevölkerung.6
SLE heute
Die immunsuppressive Therapie mit CYC ist auch heute noch oft der letzte Rettungsanker bei schwerem SLE mit Organbeteiligung, aber internationale Empfehlungen betonen immer mehr die Möglichkeit, weniger nebenwirkungsbehaftete Strategien mit MMF zu wählen.7 Jedoch: Eine Zulassung für den SLE gibt es für MMF nicht explizit, was in Österreich ein kleines, in anderen Ländern wie Deutschland aber ein durchaus ernstzunehmendes Problem darstellt, das sich vermutlich nach Ablauf des Patentschutzes auch nicht mehr lösen lassen wird.
Die Ära der Biologika hat zwar bei der chronischen Polyarthritis oder den seronegativen Spondylarthropathien mit der Einführung der TNF-Inhibitoren große Veränderungen in der Therapie gebracht, jedoch verliefen Versuche, diese oder ähnliche Therapeutika auch im SLE zu etablieren, ohne großen Erfolg. Studien zu TNFi wurden abgebrochen oder nicht weiterverfolgt, Studien mit fast allen anderen Biologika erreichten die gesetzten Endpunkte nicht oder kamen aus anderen Gründen gar nicht bis zur Phase III (Abatacept, Tocilizumab etc.).
Auch die mit großem Enthusiasmus verfolgten Studien zu Rituximab (LUNAR, EXPLORER) verfehlten die definierten Endpunkte. Gerade hier war nach vielversprechenden Fallberichten erwartet worden, dass eine gegen B-Zellen gerichtete Therapie in der stark mit Auto-Antikörpern assoziierten Erkrankung SLE wirkt.
Erst der speziell für den SLE entwickelte Anti-BlyS-Antikörper Belimumab brachte ein signifikantes Ergebnis und führte zur Zulassung bei SLE, allerdings nicht (bzw. mit starken Einschränkungen) bei Beteiligung innerer Organe.8 Bestätigt wurde der Wert der gegen B-Zellen gerichteten Therapie durch retrospektive Analysen zu Rituximab in refraktären Fällen der Lupusnephritis9, weshalb Rituximab weiter eine therapeutische Option und auch weiter Gegenstand der Forschung in klinischen Studien ist, die auch schon in diesem Journal vorgestellt wurden (RING, RITUXILUP etc.).
Viele klinische Studien mit Biologika laufen derzeit zu SLE, für Patienten mit Nephritis bzw. zu SLE ohne Beteiligung eines soliden Organs, zahlreiche sehr unterschiedliche Ziele werden anvisiert (Anti-IL17-Ak, JAK-Inhibitoren etc.). Für die meisten schweren Organbeteiligungen außer der Nephritis ist jedoch nach wie vor Cyclophosphamid die erste Wahl.
Das Potenzial von Biologika („targeted therapies“) und die Erfolglosigkeit der meisten Studien sind eines der wichtigsten Themen der Gegenwart beim SLE, was hier aber nur kurz angerissen werden kann. Als Ursache für ein negatives Studienergebnis kommen neben einer grundsätzlichen Unwirksamkeit des therapeutischen Konzepts auch andere Faktoren in Frage: Das therapeutisches Ziel war nicht geeignet oder schlecht definiert; die Population nicht gut (zu klein, zu heterogen, zu ungenau definiert); oder die Therapie im Kontrollarm war einfach zu gut, woraus sich statistisch keine Signifikanz im Vergleich ergibt.
Vielleicht braucht es auch mehr Vertrauen in die untersuchten Medikamente: Eine Steroid- Reduktion ist beim SLE ein ganz klares, prioritäres therapeutisches Ziel, das z. B. in der Belimumab-Studie nicht erreicht wurde, im „real life setting“ danach aber sehr wohl (OBSERVE-Studien bzw. Navarra et al.8).
Zur besseren Charakterisierung des SLE laufen zahlreiche Projekte. Es gibt Anstrengungen zur Definition von genetischen Untergruppen des SLE bzw. zur Etablierung genetisch und klinisch relevanter Cluster innerhalb der systemischen Autoimmunerkrankungen/Kollagenosen auf molekularer Ebene (PRECISESADS-Projekt). Eine EULAR/ACR-Gruppe betreibt die Zuschärfung der Klassifikationskriterien des SLE zur besseren Definition der Studienpopulationen u. a. mit ANA-Positivität als unumgängliches Eintrittskriterium (auf der EULAR-Tagung 2018 präsentiert). Echte Diagnosekriterien für den SLE sind eine Zukunftshoffnung.
Wünsche für die Zukunft
Natürlich ist es ein sehr wünschenswertes Ziel, von der Klassifikation des SLE für Studien ausgehend zu geeigneten Werkzeugen zur frühen Diagnose der Erkrankung mit ausreichend großer Wahrscheinlichkeit zu kommen.
In den Publikationen zum Thema sind die ersten Symptome klassisch, aber recht unspezifisch (Fatigue, Fieber, Hauteffloreszenzen, Arthralgien etc.).10 Aber gerade eine frühe Diagnose und gegebenenfalls ein früher Therapiebeginn vor dem Auftreten von Organbeteiligung und Organschädigung wäre das große Ziel, ebenso wie maßgeschneiderte Therapiekonzepte für (genetisch) prädefinierte Risiko-Subgruppen.
Ein diagnostischer Frühalarm bei Prädisposition zu einer Organbeteiligung wäre als ideal zu wünschen, die dann therapiert werden kann, bevor sie auftritt, z. B. nebenwirkungsarm durch eine Aktivierung und Vermehrung der körpereigenen regulatorischen T-Zellen (Treg) mittels niedrig dosiertem Interleukin 2 (IL-2). Zur Wirkung von Low-Dose-Il-2 gibt es derzeit mehrere Forschungsprojekte und auch klinische Studien zu SLE.
Wenn alle Wünsche erfüllt sind. In weiterer Zukunft wird die Früherkennung und Frühbehandlung des SLE so gut, dass die Patienten ohne große Störung ihrer gewünschten Lebensweise sind, hinsichtlich des sozialen Lebens, der Familienplanung, des Berufs und des ganz normalen Alltagslebens. In Ergänzung der notwendigen medikamentösen Therapie gibt es in Zukunft auch maßgeschneiderte und prospektive Rehabilitationsmaßnahmen inklusive einer intensiven und individuellen Berufsberatung, mit Empfehlungen zu einer mit der Erkrankung harmonisierten Lebensführung und gegebenenfalls für Lebensstilmodifikationen, mit Anleitungen zu sinnvoller sportlicher Betätigung. Kein SLE-Patient ist in Zukunft mehr zur Berufsunfähigkeit verdammt, sondern kann sein Leben selbstbestimmt führen. Die Therapie der Zukunft ist umfassend und beseitigt auch die für die Patienten quälende bleierne Müdigkeit, die lupustypische Fatigue.