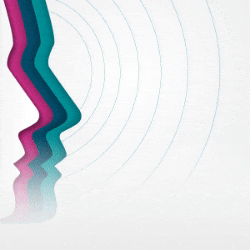Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen in dieser Ausgabe von neurologisch wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Angebot an Artikeln präsentieren zu können, die sowohl praxisrelevante Alltagsprobleme als auch neue wissenschaftliche Entwicklungen beleuchten.
Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist der Rückenschmerz. In seiner gesundheitspolitischen Bedeutung wird dieser oft nicht in der vollen Tragweite wahrgenommen. Die „Global Burden of Disease“-Studie1 konnte zeigen, dass Rückenschmerzen in Bezug auf die „Disability-adjusted life years“ (ein allgemein anerkanntes Maß für die Krankheitsbelastung der Bevölkerung) an erster Stelle aller 291 Krankheitsbilder liegen, die in dieser Studie untersucht wurden. Die globale Punktprävalenz von Rückenschmerzen liegt bei ca. 10 % der Bevölkerung. Die „Disability-adjusted life years“ stiegen von 58,2 Millionen im Jahr 1990 auf 83 Millionen im Jahr 2010. Die Ursachen sind vor allem die gestiegene Lebenserwartung und der höhere Anteil älterer Menschen in unserer Population. Dies bestätigt auch, dass der Rückenschmerz von enorm hoher allgemeinmedizinischer Bedeutung ist. In Österreich ist die Versorgung ganz wesentlich von Neurologinnen und Neurologen getragen, die oft als erste Anlaufstelle Patienten und Patientinnen mit jeder Art von Rückenschmerzen diagnostizieren und behandeln.
Umso wichtiger ist es aber auch, gemeinsam mit anderen Fachdisziplinen einheitliche Standards zu gewährleisten. Hier kommt den Neurologinnen und Neurologen eine besondere Schlüsselrolle zu, die von der frühen Erkennung von invasiv und neurochirurgisch zu behandelnden Problemen über die richtige Indikation und Interpretation von bildgebenden Daten bis hin zur Behandlung von chronischen Schmerzsyndromen reicht. Auf allen Ebenen ist die hohe Kompetenz der Neurologinnen und Neurologen Österreichs gefragt, um hier die Taktgeberrolle beizubehalten und gemeinsam mit den Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern sowie den benachbarten Fachdisziplinen die bestmögliche PatientInnenversorgung zu gewährleisten. Es ist aber auch unsere Aufgabe, vor nicht indizierten Untersuchungen und vor allem vor nicht indizierten operativen Eingriffen zu warnen, die oft den Beginn eines langen Leidensweges darstellen können, wenn sie nicht fach- und sachgerecht durchgeführt wurden. Hier gilt für mich ganz besonders, dass der Mensch mit der Erkrankung wahrzunehmen ist und nicht der Befund bildgebender Untersuchungstechniken allein darüber entscheidet, ob ein Patient/eine Patientin einer Operation zugeführt wird oder nicht. Leitlinien sollen hier helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht indizierte Untersuchungen oder Eingriffe zu vermeiden.
Wie sehr Leitlinien aber auch fehlleiten können, zeigt der Beitrag von Prof. Iglseder, der die neuen Guidelines der „European Heart Rhythm Association (EHRA)“ kommentiert. Diese europäische Fachgesellschaft hat in ihren neuen Empfehlungen deutliche Restriktionen bei der Comedikation neuer direkter Antikoagulanzien (NOAK) mit Antiepileptika eingefügt: Das wichtigste Antiepileptikum bei der „Altersepilepsie“, nämlich Levetiracetam, wurde dabei als „kontraindiziert“ eingestuft. Die Grundlage dieser Entscheidung ist ausschließlich auf tierexperimenteller Basis und ohne jegliche Daten beim Menschen geschehen.
Die von der EHRA ausgesprochenen Empfehlungen2 sind äußerst kritisch zu sehen und könnten mehr Schaden als Nutzen bringen. Die Gründe dafür sind folgende:
- Die Rate von chronischer Epilepsie nach Schlaganfall (Post-Stroke Epilepsy) beträgt ungefähr 8 % nach 5 Jahren. Die Risikofaktoren sind die Schwere des Schlaganfalls, kortikale Beteiligung sowie ein Schlaganfall im Arteria cerebri media-Stromgebiet3. Solche Schlaganfälle sind sehr häufig durch Vorhofflimmern hervorgerufen und benötigen sowohl eine lebenslange orale Antikoagulation als auch eine antiepileptische Therapie.
- Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine klinisch relevante Arzneimittelinteraktion von Levetiracetam. Die Charakteristika der linearen Pharmakokinetik, der renalen Elimination (die mit dem Alter abnimmt) und des geringen Risikos von kognitiver Einschränkung haben Levetiracetam zur ersten Wahl bei Epilepsie im höheren Lebensalter mit Multimorbidität und Polypharmakotherapie gemacht.
- Levetiracetam war in einer doppelblinden, randomisierten Überlegenheitsstudie signifikant besser verträglich als Carbamezepin4. Über 60 % der eingeschlossenen Patientinnen und Patienten hatten in dieser Klasse-I-Studie eine Post-Stroke-Epilepsie. Signifikante Unterschiede in einer Überlegenheitsstudie werden sehr selten erreicht, sodass dieses Ergebnis ein sehr hohes Gewicht hat.
- Post-Stroke-Epilepsien sind mit hoher Morbidität und auch erhöhter Mortalität verbunden5. Das Vorenthalten oder gar das Wechseln einer gut etablierten Therapie, um den Empfehlungen der Herzrhythmus-Gesellschaft zu entsprechen, setzt die Patientinnen und PatientInnen einem großen Risiko aus, Durchbruchsanfälle und sogar einen Status epilepticus zu erleiden, was mit der Gefahr von Verletzungen, Blutungen und einer zusätzlichen Hirnschädigung verbunden ist.
Aus meiner persönlichen Sicht wurden diese Empfehlungen ohne ausreichende Einbindung von epileptologischen Expertinnen und Experten sowie ohne klinisch relevante Daten erstellt. Die Interaktion mit dem P-Glycoprotein wurde aus dem Mausmodell interpretiert und nicht beim Menschen repliziert. Ich halte es daher für angebracht, Vorsicht walten zu lassen und eine entsprechende Nutzen-Risiko-Abwägung durchzuführen, bevor man das Risiko eines Therapiewechsels eingeht. Therapeutisches Monitoring des Serumspiegels von Levetiracetam und den NOAK sollte ausreichend sein, um eine subtherapeutische NOAK-Therapie zu erkennen, die mit einem erhöhten Risiko von kardial embolischen Schlaganfällen verbunden ist.
Leitlinien wie diese müssen bei der Erstellung auch die Expertise von den benachbarten und den mitbeteiligten Fachdisziplinen einholen, um den eigentlichen Zweck einer Leitlinie zu erfüllen. Dieser liegt in der besseren Information der Kliniker und Klinikerinnen, um die oft schwierigen Entscheidungen auf dem Boden der Evidenz zu erleichtern und den Patientinnen und Patienten die bestmöglichen Therapien zukommen zu lassen.
In bewährter Weise finden Sie in dieser Ausgabe zudem aktuelle Kongresshighlights und praxisrelevante Themen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen sowie beim geistreichen Nach- und Vorausdenken!
Mit kollegialen Grüßen
Ihr
Eugen Trinka