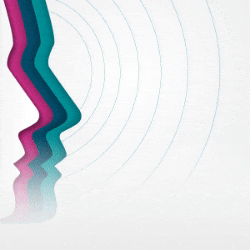EINE starke Stimme für die Krankheiten des Gehirns
Univ.-Prof. Dr. Eugen Trinka: Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man, wenn man jahrelang in einem Fach beruflich tätig ist und dieses Fach liebt, dann auch eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Verantwortung übernimmt. Und zwar für das Fach und seine Entwicklung, aber auch für den gesundheitspolitischen Auftrag, den die Fachgesellschaft ÖGN ebenfalls erfüllt. Dass das Ganze ehrenamtlich ist, spielt überhaupt keine Rolle, sondern es kommt darauf an, dass man gemeinsam mit den Neurologinnen und Neurologen den Weg in die Zukunft gestalten kann. Zudem muss man sagen: Die Neurologie in Österreich ist eine Erfolgsstory. Österreich ist beispielsweise eines der Länder weltweit mit einer vorbildlichen Schlaganfallversorgung. Wir haben durch die Arbeit meiner VorgängerInnen flächendeckend Schlaganfalleinheiten in Österreich umgesetzt. Dieser Prozess wird auch in Zukunft weitergehen. Der Schlaganfallpfad muss von der Prähospitalversorgung bis zur Rehabilitation durchgehend sein.
Die Neurologie steht vor großen Herausforderungen, denn der oft besprochene demografische Wandel hat starke Auswirkungen auf die Gehirnerkrankungen und damit auf die Neurologie. Wir werden einen starken Zuwachs an Menschen, die der älteren Generation angehören und ein gealtertes Gehirn haben, erleben. Bei der Gesamtlast aller Erkrankungen weltweit liegt die Neurologie auf Nummer 1, noch vor den Infektions- und onkologischen Erkrankungen. Bei den weltweiten Todesursachen befindet sich der Schlaganfall an der zweiten Stelle – und besonders Schlaganfälle nehmen mit dem Alter zu.
Auf der anderen Seite stehen die jüngeren PatientInnen mit seltenen neurologischen Erkrankungen; dazu gehören seltene Epilepsien, seltene Bewegungsstörungen und viele andere seltene neurologische Erkrankungen, die zunehmend genetisch entschlüsselt werden. Diese bedürfen spezifischer Therapien, die sehr teuer sind. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass bei diesen Erkrankungen die Behandlung eines Patienten/einer Patientin zwar 100.000 Euro oder gar eine Million Euro pro Jahr kosten kann, solche PatientInnen aber vielleicht nur 20-mal in Österreich vorkommen. Vor allem handelt es sich um ein Menschenleben, das genauso viel wert ist wie jedes andere auch!
Wir haben in der Gesellschaft und in der Neurologie auf der einen Seite die Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass seltene Erkrankungen zwar teuer sind, dass wir aber bei sehr vielen Fällen, die schon in der Kindheit beginnen, durch erfolgreiche Therapien einen maximalen Gewinn an Lebensqualität und Überlebensdauer erzielen können. Auf der anderen Seite müssen wir bei den häufigen neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Alzheimer-Demenz oder neurodegenerative Erkrankungen die Mechanismen noch besser verstehen und unsere Versorgungsstruktur entsprechend anpassen. Das erfordert aber, dass die Neurologinnen und Neurologen selbstbewusst auftreten. Wir sind einer der wesentlichen Träger der Volksgesundheit in Österreich und werden in der Zukunft noch eine bedeutendere Rolle spielen – sowohl im Spital und in den Krankenanstalten als auch im niedergelassenen Bereich. Unsere Fachgesellschaft wird man daran messen: Wie gut arbeiten die niedergelassenen Neurologinnen und Neurologen mit den Krankenhäusern zusammen? Wie gut können wir gemeinsam große Probleme lösen? Wir müssen uns dazu bekennen, dass es ein einziges Ziel gibt, nämlich die Diagnostik und die Therapie unserer PatientInnen zu verbessern.
Wir brauchen vor allem bei den seltenen Erkrankungen die Bildung von Zentren, in denen die PatientInnen das bekommen, was sie brauchen. Es gibt in Europa die Initiative Centres of Expertise and European Reference Networks for Rare Diseases. Diese entstand aus der Erkenntnis, dass seltene und komplexe Erkrankungen bzw. Erkrankungen, die einer komplexen Diagnostik und Behandlung bedürfen, an spezifischen Zentren betreut werden sollten. Unsere Aufgabe ist, dass wir in Österreich den Akkreditierungsprozess beschleunigen, das heißt, wir müssen aktiv daran mitarbeiten, dass diese Hochexpertisezentren auch in Österreich etabliert und designiert werden. Das Ministerium evaluiert diesbezüglich aktuell unterschiedliche Zentren. Wenn diese einmal laufen, wird das eine Veränderung im Gesundheitssystem bewirken. Das bedeutet dann nämlich, dass die PatientInnen nicht mehr an das Bundesland, in dem sie wohnen, gebunden sind, sondern dass auf europäischer Ebene das Recht besteht, in einem dieser Netzwerke eine entsprechende Diagnose/Behandlung zu erhalten und anschließend am Heimatort weiter therapiert zu werden.
Eine weitere aktuelle Aufgabe von uns besteht darin, die Spezialisierung für neurologische Intensivmedizin auch in der Zukunft weiter zu sichern. Zudem benötigen wir auch entsprechende Strukturen, damit die PatientInnen in neurologischen Intensivstationen, die durchaus interdisziplinär geführt werden können, behandelt werden.
Zudem hat die ÖGN natürlich die Aufgabe, möglichst viel für unsere Mitglieder – sowohl im niedergelassenen als auch im Klinikbereich – zu tun. Dazu gehören u. a. ein Literaturservice und die Verbreitung von Informationen, die für den praktischen Alltag relevant sind. Wir müssen eine Plattform für Austausch bieten. Dabei spielt unsere Jahrestagung eine wesentliche Rolle. Zudem müssen wir uns mit den benachbarten sowie mit unseren Tochtergesellschaften wie der Gesellschaft für Epileptologie, der Gesellschaft für Schlaganfallmedizin, Kopfschmerz, Rehabilitation, Parkinson, Demenz usw. um einen intensiven Dialog bemühen. Wir müssen gemeinsam Ziele definieren: Was wollen wir beim Ministerium für Gesundheit erreichen? Was wollen wir in den Gesprächen mit der Ärztekammer erreichen? Wenn wir uns hier auseinanderdividieren lassen, ist das zum Schaden aller. Wir müssen mit einer Stimme sprechen. Beispiele dafür sind öffentlichkeitswirksame Aktionen wie zum Beispiel der Weltkopfschmerztag, der Fit for Brain Run und Ähnliches mehr. Für unsere gesundheitspolitische Bedeutung im Dialog mit dem Ministerium oder im Dialog mit der Europäischen Union brauchen wir eine starke Stimme für die Krankheiten des Gehirns. 30 % der Bevölkerung sind in Österreich gehirnkrank, und eine ganze Gruppe von MedizinerInnen ist dafür zuständig, nämlich Neurologinnen und Neurologen, PsychiaterInnen sowie NeurochirurgInnen. Ein engerer Schulterschluss zwischen den verschiedenen benachbarten Fachgesellschaften ist aus meiner Sicht notwendig, wenn man etwas erreichen will – und da sind auch bereits erste Gespräche im Laufen. Auf europäischer Ebene gibt es dafür ein sehr schönes Modell: das European Brain Council (EBC). Diese Non-Profit-Organisation hat in der Europäischen Union sehr viel erreicht, in dem sie die Bedeutung dieser Hirnerkrankungen für die Gesundheitspolitik sehr, sehr gut dargestellt hat. Das EBC hat fächerübergreifende epidemiologische Studien, gesundheitsökonomische Studien und andere Projekte verfolgt, um der EU zu erklären, wie wichtig es ist, dass man in Forschung, aber auch in Patientenversorgung investiert.
Wir haben so viele junge Assistenzärztinnen und Assistenzärzte wie noch nie. Die Frage ist: Wie viele bleiben in Österreich, wie viele gehen in andere Länder, und wie viele von denen können wir in die Neurologie führen? Außerdem werden wir den Peak der Bevölkerung mit einer sehr hohen Krankenhausaufenthaltswahrscheinlichkeit erst in den nächsten Jahren haben. Wie und in welcher Form wir das lösen werden, ist völlig unklar, weil wir die notwendigen Strukturen in Österreich noch nicht haben. Aber das ist ein intensiver Dialog mit dem Bundesministerium: Was ist der tatsächliche Bedarf? Die gute Nachricht ist, dass seit der „Ärzteausbildungsordnung neu“ mehr Ärztinnen und Ärzte in die Neurologie gehen.
Ich glaube, wenn wir gemeinsam mit den Schwestergesellschaften und Tochtergesellschaften Ziele formulieren und eine Strategie entwickeln, wie wir diese erreichen können, haben wir viel geleistet. Zudem bin ich der Überzeugung, dass ein attraktiver Kongress eines der wichtigsten Mittel ist, um die Gesellschaft zusammenzubringen und uns in unseren Themen weiterzubringen. Weiters sollten wir ein Curriculum für Fortbildungsveranstaltungen – sowohl für die jungen als auch für die Neurologinnen und Neurologen mit mehr Erfahrung – erstellen. Als weiteren Punkt halte ich den Dialog mit dem Bundesministerium für essenziell. Ich bin der Ansicht, dass wir bei den Schlaganfalleinheiten eine Modellsituation vorweisen können, aber bei der neurologischen Intensivmedizin und den neurologischen Rehabilitationszentren mit der Phase B sieht die Situation anders. Auch bei den Zentren für präoperative Epilepsiediagnostik und Epilepsietherapie sowie für extrapyramidale Chirurgie sind wir von einer Modellsituation noch entfernt. Hier gilt es, Verbesserungen zu implementieren. Daran wird man mich messen, ob ich diese Ziele erreicht habe oder nicht.
Als Erstes wie bereits erwähnt der demografische Wandel. Da stehen wir alle vor einer enormen Aufgabe, die man nicht in einer Legislaturperiode lösen kann. Wir müssen konsequent Aus-, Fort- und Weiterbildung anbieten; wir brauchen konsequente Forschung in Österreich, auch über das Land hinaus. Zudem müssen Neurologinnen und Neurologen bei der Versorgung der PatientInnen mit den AllgemeinmedizinerInnen zusammenarbeiten.
Gemeinsame Netzwerke und gemeinsamer Einsatz für dieselben Ziele sind wesentliche Schlüsselfaktoren. Wir müssen die Probleme der PatientInnen mit neurologischen Erkrankungen für jeden Player im Gesundheitssystem ersichtlich machen. Wir müssen uns klar positionieren und unsere Anliegen deutlich kommunizieren.
Die Information der Bevölkerung über neurologische Themen nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein. Aus folgendem Grund: „Time is Brain!“ – das gilt nicht nur beim Schlaganfall, sondern für so gut wie alle neurologischen Erkrankungen. Dazu braucht man noch erhebliche Forschung, denn manchmal sind wir mit der Diagnose der ersten Symptome sehr spät dran. Das bedeutet unter anderem, dass auch die AllgemeinmedizinerInnen über die „Red Flags“ informiert werden müssen, damit möglichst frühzeitig eine Diagnose gestellt und eine entsprechende Therapie eingeleitet werden kann.
Die Komplexität des Faches ist eine Herausforderung. Daher ist die entscheidende Frage: Wie kann ich es für die Jungen attraktiv machen? Es muss gelingen, die Sachverhalte, seien sie auch noch so komplex, so einfach darzustellen, dass ein Student/eine Studentin es leicht verstehen kann. Es darf im Laufe der Ausbildung keine Zäsur geben, d. h., man muss den Übertritt an die Klinik begleiten. Dafür gibt es verschiedene Modelle wie z. B. Mentorensysteme. Zudem müssen die jungen Neurologinnen und Neurologen dabei unterstützt werden, Erfahrung im Ausland sammeln zu können. Daher gibt es u. a. das Mobilitätsstipendium der ÖGN. Wenn man solche zeitlich befristeten Auslandsaufenthalte ermöglicht, kommt der Nachwuchs danach um viele Erfahrungen reicher wieder zurück.
Vielen Dank für das Gespräch!