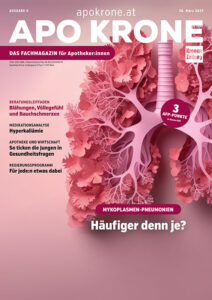Die Seele der Allgemeinmedizin
Zugegeben: Ich freue mich darauf, wenn wir in unseren Praxen durch Digitalisierung und KI Unterstützung im hausärztlichen Alltag haben werden – dies scheint auch schneller zu kommen, als man vielleicht denken mag. Zugegeben aber auch: Ein bisschen ein komisches Gefühl bleibt. Seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden haben Ärzt:innen (wenn auch vielleicht nicht immer wissenschaftsbasiert) Diagnosen und Therapien für ihre Patient:innen gestellt und waren auch als individuelle Personen zuständig für Leid und Krankheit der Erkrankten und nicht nur der Krankheiten ihrer Patient:innen.
Bei aller Unterstützung, die uns der technologische Fortschritt bringen wird, bleibt aber eine der wesentlichsten Fragen, die uns und sicher auch unsere Patient:innen in Zukunft beschäftigen wird, die Frage, was unsere ärztliche Kunsteigentlich ausmacht und wie wir unsere Rolle und die Beziehung zu unseren Patient:innen zukünftig definieren und ausüben.
Gerade erfahrene Ärzt:innen sind sicher bei dem neuen Slogan der Gesundheitspolitik „digital vor ambulant vor stationär“ zurückgeschreckt.
Wir wissen durch langjähriges Tun, das wir einen Großteil der Informationen, die wir benötigen, um ein Bild der Erkrankten in ihrer Gesamtheit erstellen zu können, darauf beruht, dass wir sie erleben – wie sie in ihrer Person und Individualität vor uns sitzen, mit uns sprechen, wie sie reagieren, kommunizieren. Wir erfahren die meisten wichtigen Informationen, wenn wir sie körperlich unter Inanspruchnahme und Berücksichtigung aller Sinnesreize untersuchen – und nicht zuletzt bei großem Leid oder Kummer auch trösten, eine Hand halten, eine Schulter berühren oder in den Arm nehmen. Wir wissen, dass die Medizin weder eine Natur- noch eine Handlungswissenschaft ist, sondern eher durch den Begriff der „Humanwissenschaft“ definiert werden muss. Klar ist bei der Medizin aber, dass sie nur dort stattfinden kann, wo Menschen auf Menschen treffen und in der Begegnung der Hilfesuchenden mit den Hilfegebenden lebendig wird.
Wir wissen aus zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass von der Kontinuität der Arzt-Patienten-Beziehung unsere Patient:innen mit besserer Gesundheit und längerem Leben profitieren. Wir wissen auch, dass Vertrauen in der Beziehung zwischen Ärzt:innen und Patient:innen eine höhere Therapietreue und die Kontinuität der Beziehung fördert.
Welches Glück haben wir als Fachärzt:innen für Allgemein- und Familienmedizin, dass wir gerade durch die unserem Fach als Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen medizinischen Spezialfächern innewohnende Arbeitsweise diese Werte tagtäglich leben dürfen und dadurch unseren Patient:innen einen großen Nutzen erweisen.
Zudem können wir durch die unserem Fach zugrundeliegende ärztliche Arbeitsweise den Werten ärztlicher Arbeit, die schon Hippokrates gelehrt hat, sehr nahekommen. Sicherlich stellt es zukünftig in Zeiten der Hochtechnologie einen noch immenseren Wert dar, dass wir in der vertrauensvollen, persönlichen Begegnung gerade diese Tugenden leben und auch unseren Studierenden und Auszubildenden vorleben können – denn gerade durch diese spürbaren, direkten Erlebnisse kann der Wert ärztlich ethischen Handelns am glaubwürdigsten und nachhaltigsten vermittelt werden.
Bedienen wir uns einer altruistischen Handlungsweise, nach der hippokratisch unser Tun zum Nutzen und Frommen der Kranken ausgerichtet sein sollte, lenken wir den Fokus weg von größtmöglicher Gewinnoptimierung. Durch unser oft Anwält:innen unserer Patient:innen ähnelndes Verhalten können wir unsere Patient:innen vor Schaden und Unrecht bewahren, was auch den wichtigen Schutz vor Über-, Unter- und Fehlversorgung beinhaltet. Der Schaden kann durch mangelnde Ressourcen eines massiv geforderten Gesundheitssystems und der zunehmenden Entsolidarisierung entstehen, aber oft auch durch die mangelnde Partizipation der Patient:innen an der Entscheidung für medizinische Maßnahmen. Die Aufgabe, die Autonomie und die Würde unserer Patient:innen zu beachten, fordert uns einerseits heraus, uns aus der paternalistischen Rolle zu befreien und in eine symmetrische Beziehung zu gehen, anderseits eröffnet sich dadurch für uns die Möglichkeit, die Menschenwürde, die zwar als unantastbar im Grundgesetz verankert ist, aber im Leben und oft in schweren Krankheitssituationen durch die Verletzung des Selbstbildes gefährdet ist, wiederherzustellen und zu wahren. Keine andere Fachrichtung bietet die unserem Fach immanente Möglichkeit der individuellen Anteil- und Rücksichtnahme, die durch eine lange erlebte Anamnese und das Wissen um die persönlichen Umstände sowie die durch Kontinuität geprägte Beziehung erst möglich wird. Der Verletzung körperlicher und psychischer Integrität, die erkrankten Patient:innen widerfährt, kann gerade im hausärztlichen Umfeld durch eine ärztliche Haltung, deren Maxime eine von Empathie, Vertrauen und Wohlwollen geprägte Arzt-Patient-Beziehung sein sollte, entgegnet werden. Das Privileg, Menschen in ihrer Ganzheit, Individualität und Komplexität als kranke Menschen und nicht nur deren Krankheiten behandeln zu dürfen, ist ein kostbares hausärztliches Gut, das ein unermüdliches Bemühen um Reflexion des eigenen ärztlichen Handelns, der Anerkennung der eigenen Begrenztheit und der Dankbarkeit zur Folge haben sollte. Eine ärztliche hippokratische Haltung einzunehmen und weiterzugeben stärkt in Zeiten sich mehrender Krisen und politischer Herausforderungen durch das Bestehen auf die Autonomie ärztlichen Handelns die Resilienz der handelnden Personen und schützt Patient:innen und Ärzt:innen vor Ungleichbehandlung und Instrumentalisierung.