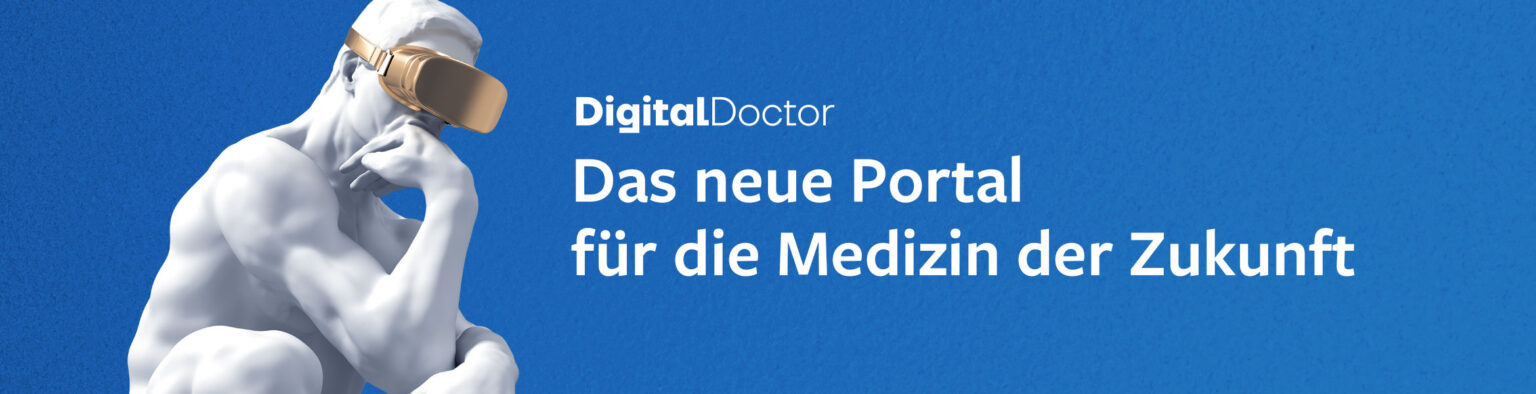Stoffungebundene Suchtformen
Jede:r von uns nutzt digitale Medien wie Smartphone, Tablet oder PC. Und jede:r schätzt die Möglichkeiten, die diese Geräte bieten. Sie führen und begleiten uns durch das gesamte Leben, indem sie uns wecken, uns durch Zeit und Raum navigieren und uns ständig mit mehr News versorgen, als wir verarbeiten können. Sogar unser Schlaf wird mittlerweile durch Sleep-Tracker digital überwacht.
Smartphone und Co sind nicht nur „digitale Helferlein“ für den Alltag, sie ermöglichen auch die immer schnellere Übertragung großer Datenmengen, sodass eine unglaubliche Vielfalt von Videostreaming, Online-Spielcasinos, Online-Spielangeboten und Online-Pornografie für jede:n und zu jeder Zeit verfügbar und leistbar geworden ist. Das Tempo und die Bildqualität der digitalen Angebote machen die Grenzen zwischen Realität und virtueller Welt zunehmend unkenntlich. Die Verführungen der digitalen Welt werden so immer präsenter und dominieren unser soziales Leben immer stärker.
Zur aktuellen Orientierung werden in diesem Artikel die Big Five der meistgenutzten Bereiche im Internet dargestellt.
Die Big Five der stoffungebundenen Süchte
Online-Gaming
Das „Miteinander-Spielen“ verschiebt sich seit Jahren immer mehr in den Online-Bereich, vor allem bei Jugendlichen. Zuerst fand Online-Gaming noch als Ergänzung zu anderen Aktivitäten wie dem gemeinsamen Fußballspielen, dem gemeinsamen Musizieren oder dem Treffen mit Freund:innen und Bekannten statt. Online-Spiele waren eine Alternative, um mit Freund:innen gemeinsam aktiv zu sein, wenn ein Treffen anderweitig nicht oder nur eingeschränkt möglich war, beispielsweise bei schlechtem Wetter.
COVID-19 als Gamechanger: Seit der COVID-19-Pandemie hat sich die Freizeitaktivität junger Menschen allerdings massiv in den virtuellen Raum verlagert. Sportvereine waren damals geschlossen und Parks gesperrt. Den Jugendlichen blieb oft der PC als einzige Möglichkeit, um mit Freund:innen in Kontakt zu bleiben.
Der Anteil der Online-Zeiten pro Tag hat sich in dieser Zeit vervielfacht. Nach Ende der Lockdowns ging er zwar wieder zurück, jedoch sind viele junge Menschen, vor allem diejenigen, die zuvor schon intensive Gamer:innen waren, beim exzessiven Internetkonsum hängen geblieben und gelten heute häufig als onlinesüchtig.
Klassifizierung und Suchtkriterien: Diagnostisch findet sich die Internetsucht im ICD-10 nicht bei den Suchterkrankungen, sondern ist den Impulskontrollstörungen, F63, zugeordnet. Im neuen ICD-11-Katalog wurde jedoch ein Teilbereich der Internetsucht, nämlich „krankhaftes Video- oder Onlinespielen“ als 6C51 kodiert und den Verhaltenssüchten zugeordnet.
Die Kriterien dieser Kodierung sind Suchtkriterien, wie wir sie auch von der Diagnostik der Alkoholabhängigkeit kennen. Im digitalen Bereich ist es das „Craving“ – der starke Drang, online zu sein: Der resultierende „Kontrollverlust“ bezeichnet die Unfähigkeit, den Zeitpunkt und die Zeitdauer des Spielens im Griff zu haben. So wird zu Zeiten gespielt, in denen eigentlich andere Dinge im Leben gerade wichtiger sind, oder es wird länger gespielt, als man eigentlich wollte.
Die „Toleranzentwicklung“ beschreibt die zunehmende Intensität des Spielens: Man spielt immer häufiger sowie oft immer länger und erlebt Zufriedenheit erst bei intensivem Spielen. Durch die „Fokussierung“ auf die virtuelle Welt werden andere Interessen zunehmend vernachlässigt. Trotz negativer Konsequenzen, wie etwa der Abnahme schulischer Leistungen oder Konflikten mit wichtigen Bezugspersonen, kann das Spielen nicht mehr eingeschränkt werden. Es treten vielmehr „Entzugssymptome“ auf, wenn einmal nicht gespielt werden kann. Die Betroffenen werden unruhig, gereizt oder können Angstzustände entwickeln.
Social Media
Gerade bei jungen Menschen stehen soziale Netzwerke wie Instagram, Snapchat, TikTok oder WhatsApp im Zentrum ihres „sozialen“ Lebens. Zum einen werden Erlebnisse gepostet und mit anderen geteilt, zum anderen dienen diese Plattformen dem Zeitvertreib und dem oberflächlichen „Sich-berieseln-Lassen“.
Als erste dieser Plattformen, die sich breit durchsetzen konnte, kam Facebook 2004 auf den Markt, gegründet von dem US-amerikanischen Unternehmer Mark Zuckerberg. Neuartig war der dahinterstehende Algorithmus, der zum Einsatz kommt: Facebook liefert uns täglich (neue) Inhalte, von denen es meint, dass sie uns interessieren. Außerdem werden neue Freundschaften angeboten, und die von bestehenden Freund:innen geposteten Inhalte werden präsentiert. Durch Likes können Inhalte bewertet werden, sie fungieren als eine Art „soziale Währung“: Je mehr Likes man erhält, umso attraktiver und wertvoller fühlt man sich.
Zum Facebook-Konzern (heute Meta) gehört auch Instagram, das als Foto- und Video-Sharing-Dienst 2010 in San Francisco, USA, gegründet wurde. Das geschriebene Wort hat auf dieser Plattform eine eingeschränkte Bedeutung, „Insta“, wie es in der Umgangssprache oft genannt wird, lebt von Fotos und Videos, die durch diverse Filter bearbeitet und „verschönert“ werden können, um auf diese Weise perfekte Bilder von sich in der digitalen Welt verbreiten zu können.
Ein Selfie zu posten und dann auf Zustimmung – die Likes – zu warten kann aber auch süchtig machen. Wer ein paar Stunden nicht eingeloggt ist, bekommt Nachrichten wie „Jemand hat dein Foto gelikt“ oder „Ein Freund hat etwas gepostet“. Dies verleitet dazu, wieder online zu gehen, um ja nichts zu verpassen, und schon verbringt man mehr Zeit auf Social Media, als man eigentlich wollte.
Online-Pornografie
Kein Bereich in der virtuellen Welt wächst so rasch wie jener der Online-Pornografie. Täglich werden tausende neue Seiten generiert, mit einem schier unendlichen Angebot an Filmen und Bildern mit allen nur erdenklichen sexuellen Inhalten. Auch wirtschaftlich ist dieser Bereich für die Anbieter offenbar hoch lukrativ. Immerhin setzt die Online-Pornografie mehr Geld um als die gesamte Filmindustrie Hollywoods.
Durch dieses ständig wachsende Angebot an pornografischen Seiten im Internet konsumieren immer mehr Menschen exzessiv Pornos und entwickeln eine Online-Sexsucht. Sexsüchtige leben ihre Sexualität zunehmend im Internet aus und vernachlässigen die partnerschaftliche Sexualität, was zu Konflikten bis hin zu Trennung und Zerstörung einer Familie führen kann.
Betroffene und ihr Konsum: Die Betroffenen sind in aller Regel Männer mittleren Lebensalters und meist sozial gut integriert, d. h., sie leben in einer Beziehung und gehen einem Beruf nach.
Rund ein Viertel aller Anfragen im Internet dreht sich zurzeit um Pornografie. Weltweit besuchen 43 % aller Internet-User:innen pornografische Seiten, Männer durchschnittlich 70 Minuten pro Woche. Bemerkenswert ist, dass 70 % des Pornokonsums über das Internet an Werktagen zwischen 9 und 17 Uhr stattfinden, also während der üblichen Arbeitszeiten.
Es gibt außerdem Hinweise, dass ein exzessiver Pornokonsum zu einem „Ausleiern“ des Belohnungssystems führen kann. So werden immer intensivere Reize benötigt, um eine sexuelle Erregung erleben zu können.
Online-Gambling
Das Glücksspiel hat sich in den letzten Jahren nicht nur in Österreich immer mehr zu Online-Anbietern verlagert. Auch wenn Lotto in Österreich das am häufigsten genutzte Glücksspiel ist, haben andere Spielprodukte wie Slots (Automatenspiel), Roulette oder Kartenspiele wie Black Jack ein weit höheres Suchtpotenzial, sind also deutlich gefährlicher für die Entwicklung einer Abhängigkeit. Dieser Umstand erklärt sich durch deren höhere Ereignisfrequenz, also die Dauer eines Spieles: Je kürzer die Ereignisfrequenz, umso höher die Suchtgefahr.
Bei einem klassischen Lottospiel liegt die Frequenz bei 3 bis 4 Tagen: So lange dauert es vom Ausfüllen des Scheins bis zur Ziehung. Bei einem Spielautomaten liegt dieser Wert oft nur bei 2 Sekunden.
Sportwetten nehmen eine Sonderstellung ein, da diese in Österreich gesetzlich nicht als Glücksspiel gelten, sondern als so genanntes Geschicklichkeitsspiel. Die Behandlungseinrichtungen werden jedoch immer häufiger von Betroffenen aufgesucht, die bei Sportwetten ihre Existenz gefährden, weil sie ihr Wetten nicht mehr kontrollieren können.
Die Gefahren des Online-Glücksspiels liegen in dessen uneingeschränkter Verfügbarkeit und in seiner realitätsnahen Darstellung durch immer ausgereiftere technische Angebote. Das heißt, wann immer ich will, kann ich an Glücksspielen teilnehmen oder bei Fußballspielen meine Wetten sofort platzieren. Je riskanter gespielt wird, umso größer ist der „Kick“, der sogenannte Spielrausch. Durch ein riskantes Spiel erhöhen sich meist auch die Verluste. Spieler:innen, die sich in therapeutische Behandlung begeben, sind durchschnittlich mit 60.000 Euro verschuldet.
Online-Shopping
Die Zunahme digitaler Shopping-Angebote verlagert sich auch beim Einkaufen zunehmend auf virtuelle Marktplätze. Verstärkt wurde dies durch die COVID-19-Pandemie, zu Zeiten der Lockdowns, als alle Geschäfte – außer jener für den täglichen Bedarf – über lange Zeit geschlossen waren. Gleichzeitig haben Anbieter wie Amazon ihr Portfolio verbreitert und auch eine immer besser funktionierende Lieferlogistik aufgebaut.
Während der Pandemie gab es Zeiten, in denen bei leergefegten Straßen primär Amazon-Zusteller:innen oder Foodora-Lieferant:innen unterwegs waren. Das war auch praktisch, weil man so Dinge, die man brauchte, oder Geschenke online bzw. überhaupt kaufen konnte. Für viele Menschen war das Online-Shopping aber auch der Versuch einer Kompensation ihrer belastenden Lebenssituation, weil viele durch Homeoffice, Kinder im Homeschooling oder Jobverlust psychisch belastet waren.
Auffallend ist, dass das virtuelle Kaufverhalten auch nach Beendigung der Lockdowns beinahe gleich geblieben ist. Online-Einkaufen kann jedoch, weil jederzeit und an jedem Ort verfügbar, zu einem vermehrten Konsum führen und somit auch ein pathologisches Kaufverhalten fördern.
Typisch für eine Kaufsucht ist das Einkaufen von Dingen, die meist gar nicht benötigt werden: Es geht um den Kaufakt an sich. Die Betroffenen erleben während des Kaufens positive Gefühle wie Wertschätzung, Belohnung und eine gewisse Selbstwertsteigerung. Sobald der Kaufakt vorüber ist, verschwinden diese positiven Gefühle jedoch rasch – es braucht daher einen neuen Einkauf.
Behandlung von Online-Süchten
Cool-down-Phase: Zu Beginn der Behandlung steht in aller Regel der vorübergehende Verzicht auf digitale Medien. Diese „Cool-down-Phase“ ermöglicht den Betroffenen, den exzessiven Konsum akut zu durchbrechen. Meist wird diese Phase auch als erleichternd und befreiend erlebt.
Offline-Lebensinhalte neu entdecken: Wichtig ist, schon hier zu beginnen, einen Fokus auf derzeitige oder vergangene Interessen und Freizeitaktivitäten zu legen, um neue Lebensinhalte (wieder) zu entdecken.
Grundsätzlich liegt der Internetsucht das Phänomen zugrunde, dass sich die meisten Betroffenen online besser fühlen als offline.
Deswegen gilt als zentraler Therapieansatz, die Betroffenen behutsam wieder in die reale Welt zurückzuführen, indem man sie dabei unterstützt, die „wirkliche“ Welt attraktiver zu machen und positive Effekte aus der virtuellen Welt in den realen Alltag zu übertragen.
Virtuelle Angebote als Verführung aus der Wirklichkeit begreifen: Wenn sich ein:e Gamer:in im Online-Rollenspiel beispielsweise einen Avatar erstellt und diesen mit Superkräften ausstattet, um im Spiel erfolgreich und attraktiv zu sein, löst dies positive Gefühle wie Anerkennung und Zuwendung aus; Gefühle, die er/sie im realen Leben möglicherweise (derzeit) nicht erlebt. In therapeutischen Einzel- und Gruppengesprächen muss dann daran gearbeitet werden, die positiven Eigenschaften der Spielfigur möglichst in die reale Welt zu transformieren, um die Verführung der virtuellen Welt abzuschwächen.
Achtsamen Einsatz digitaler Medien anstreben: Die völlige Abstinenz als Therapieziel ist bei der Internetsucht nicht realistisch und auch nicht sinnvoll. Ein Leben ohne Internet ist in unserer Gesellschaft praktisch undenkbar geworden. Das Behandlungsziel ist daher Medienkompetenz, um einen achtsamen, kontrollierten Einsatz mit digitalen Medien zu erreichen.
| Regeln im Umgang mit Online-Sucht |
|---|
|