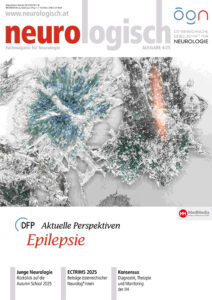Orthopädie-Kongress: Patientensicherheit im Fokus
Organisiert wurde die Jahrestagung von der European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) gemeinsam mit der British Orthopaedic Association (BOA). Ein thematischer Schwerpunkt des Kongresses: Patientensicherheit. „Die größten Fortschritte der Medizin kommen bei den Menschen nicht an, wenn die nötigen Vorkehrungen zur Patientensicherheit fehlen“, warnte Univ.-Prof. Dr. Pierre Hoffmeyer, Universitätsklinik Genf. Einige alarmierende Beispiel: Pro Woche werden in Europa 50 Operationen an der falschen Stelle oder an den falschen Patienten durchgeführt. 15–20% der postoperativen Infektionen wären durch mehr Hygiene vermeidbar. In 20 untersuchten OECD-Ländern tauchen pro 100.000 Spitalsakten von erwachsenen Patienten fünf Fälle auf, bei denen während der OP ein Fremdkörper in den Operierten vergessen wurde.
„In den vergangenen Jahren haben wir in der Orthopädie die Einführung von neuen Materialien, neuen Techniken und neuen Medikamenten erlebt. Immer wenn es solche neuen Entwicklungen gibt, müssen wir den besten Weg finden, um unseren Patienten solche Innovationen zugänglich zu machen, ohne sie aber einem Risiko auszusetzen“, betonte EFORT Präsident Prof. Manuel Cassiano Neves, Lissabon. „Entscheidend ist, dass wir diesem Problem interdisziplinär und auf integrierte Weise begegnen.“
Komplexe Kulturveränderungen
In den USA wird beispielsweise bereits seit Jahren propagiert, Patienten einen Tag vor der OP mit einem Stift zu markieren, um am nächsten Morgen sicherzugehen, dass der richtige Chirurg die richtige Person an der richtigen Stelle operiert. Theoretisch eine sehr einfache Idee, praktisch betrachtet muss eine komplexe Krankenhauskultur geändert werden: Vom immer und überall verfügbaren Stift über Anästhesisten, die sich weigern, nichtmarkierte Patienten zu narkotisieren, bis hin zu einer Spitalsleitung, die in Kauf nimmt, dass unter Umständen weniger Operationen durchgeführt werden.
Vor, während und nach einer Operation sollte das Vorgehen nach Checklisten selbstverständlich sein, so Hoffmeyer. Die meisten nationalen Fachgesellschaften hätten entsprechende Empfehlungen herausgegeben, dennoch setzten sie sich erst langsam durch. „In vielen Krankenhäusern mag es zwar Checklisten geben, doch mit der tatsächlichen Anwendung gibt es nach wie vor Probleme.“ Es sei aber die denkbar schlechteste Situation, ohne solche Kontrollen anzunehmen, dass für alles gesorgt sei und alle Bescheid wüssten. Eine groß angelegte internationale Studie belegte, dass die Sterblichkeitsrate nach Einführung von Checklisten von 1,5% auf 0,8% sank. Auch die Komplikationsrate konnte von 11 auf 7% gesenkt werden.
Stark Übergewichtige brauchen doppelt so oft Gelenksersatz
Die Übergewichtsepidemie ist in der Orthopädie angekommen: Wer heute einen Hüft- oder Knieersatz bekommt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit übergewichtig, berichteten Experten. Das stellt die orthopädische Chirurgie vor große Herausforderungen, denn wer allzu viele Kilos auf die Waage bringt, muss eher mit Komplikationen rechnen, zeigen neue Studien.
Menschen, die heute ihren ersten Knie-Ersatz brauchen, sind tendenziell dicker als Prothetik-Kandidaten vergangener Jahrzehnte, zeigt eine schottische Langzeitstudie. Verglichen wurden 686 Patienten, denen zwischen Dezember 1994 und August 1998 eine primäre Knie-Totalendoprothese angepasst wurde, mit 1.408 Patienten, die diesem Eingriff zwischen Jänner 2009 und November 2012 unterzogen wurden. „Die Patienten in der zweiten Gruppe hatten mit durchschnittlich 32,0 kg/m2 einen deutlich höheren BMI als die Patienten der ersten Gruppe – diese brachten es im Schnitt auf 29,4 kg/m2,“ berichtete Studienautor Dr. Ewan Barclay Goudie, Victoria Hospital, Kirkcaldy.
Ab wann ein erhöhter Body-Mass-Index (BMI) problematisch wird, zeigt eine neue Schweizer Studie: „Vor allem Adipöse ab einem BMI von 35 kg/m2 sind Risikokandidaten für Nachoperationen und Infektionen. Sie hatten im Vergleich zu den Patienten, die unter diesem Wert lagen, doppelt so oft Revisionen nötig und litten zweimal so oft an tiefen Infektionen. Bei Männern wirkte sich der hohe BMI stärker aus als bei Frauen“, berichtete Dr. Matthieu Zingg, Universitätsklinik Genf. Für die Studie waren die Daten von fast 2.500 Knieprothetik-Patienten ausgewertet worden.
Mit den Kilos steigt der Bedarf an Prothesen, wie eine aktuelle nordirische Studie belegt: „Im Vergleich zur nordirischen Gesamtbevölkerung haben adipöse Männer ein doppelt so hohes Risiko, einmal ein künstliches Kniegelenk zu benötigen, bei adipösen Frauen ist das Risiko sogar 2,4-mal so hoch. Das sind alarmierende Zahlen, auf die mit wirkungsvollen Programmen zur Adipositas-Prävention reagiert werden sollte, um den enormen Bedarf an Endoprothetik und die drastische Kostenentwicklung im Gesundheitssystem zu dämpfen“, so Dr. Christopher O’Neill, Musgrave Park Hospital, Belfast. Für die Studie wurde der Body-Mass-Index von 1.000 Personen erfasst, die eine Knietotalendoprothese erhalten sollten. Mehr als 90% der Studienteilnehmer waren übergewichtig, während in der nordirischen Allgemeinbevölkerung dieser Wert bei 59% liegt. 28,5% der Studienteilnehmer hatten einen BMI von 25,0–29,9 kg/m2, fast 62% waren adipös (BMI> 30,0 kg/m2). Frauen schnitten schlechter ab als Männer.
Neues Operationsverfahren für Adipöse
Orthopädische Chirurgen sollten künftig maßgeschneiderte patientenspezifische Schablonen als Führung verwenden, wenn sie Adipösen eine Knieprothese anpassen, und die Größe von Komponenten, Achsstellung und Rotation gemäß den üblichen chirurgischen Prinzipien justieren, so die Empfehlung des australischen Chirurgen Prof. Warwick Bruce und des britischen Chirurgen Dr. Rahij Anwar. „Sie steigern die Genauigkeit, reduzieren Blutverlust und Operationszeit und helfen zudem, die Größe von Schnitten und Implantaten bei Patienten mit hohem BMI richtig zu bemessen. Mit patientenspezifischen Schablonen kann zudem die mechanische Achse verlässlich wiederhergestellt werden“, so Anwar.
Risikofaktor Infektionen bei Gelenks-Operationen
Postoperative Infektionen (surgical-site infections, SSI) gehören zu den häufigsten Krankenhausinfektionen. Sie treten bei 0,7% der Knieprothesen-Operationen und einem Prozent der Hüftprothesen-OP auf, zeigt eine Analyse des European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Sie gehören zu den häufigsten Ursachen für das Abstoßen der Prothesen, bei Hüftprothesen-Implantationen enden sie laut ECDC-Bericht in einem von 200 Fällen sogar tödlich.
Dass Frakturpatienten, die eine künstliche Hüfte bekommen, ein signifikant höheres Infektionsrisiko haben als Menschen, die aufgrund einer degenerativen Hüfterkrankung operiert werden, zeigt eine groß angelegte schwedische Kohortenstudie. „Am häufigsten, nämlich in 2,8% der Fälle, wurden Prothesengelenksentzündungen in der Gruppe mit sekundärer Frakturprothetik gefunden, also bei Personen, bei denen beispielsweise eine interne Fixation missglückt war. Etwas geringer fiel die Inzidenz mit 2,1% bei Patienten aus, die erstmalig eine Prothese aufgrund eines Knochenbruchs erhalten hatten. Deutlich weniger Infektionsfälle gab es hingegen bei Menschen, die aufgrund einer Abnützungserscheinung operiert wurden. Bei dieser Gruppe kam es nur in 0,8% der Fälle zu einer Infektion“, berichtete Studienleiter Dr. Piotr Kasina, Karolinska Institutet, Stockholm. Seine Forschergruppe hatte 3.807 Fälle untersucht, die zwischen 1996 und 2005 am Stockholmer Allgemeinen Krankenhaus Süd behandelt worden waren.
Die schwedische Studie zeigt auch, wie schwierig sich die Infektionsbehandlung erweisen kann: Nur in 40% der Fälle konnte die Infektion ausgeheilt werden, in 42% war das Infektionsgeschehen erst nach einer permanenten Resektionsarthroplastik beherrschbar, das Gelenk musste also dauerhaft entfernt werden. Davon waren fast ausschließlich Frakturpatienten betroffen.
In 10% der Fälle war eine lebenslange Antibiotikatherapie erforderlich. 8% der Patienten verstarben während der Behandlung. „Adäquate Prophylaxemaßnahmen sind nötig, vor allem gegen Staphylococcus aureus und koagulasenegative Staphylokokken, die bei Frakturpatienten meist ausschlaggebend für den Infekt sind“, so Kasina.
Neue Biomarker zur Infektionsdiagnose
Nicht nur die Therapie von periprothetischen Gelenkinfektionen, sondern auch deren Diagnose stellt die Fachwelt vor Herausforderungen. Mit den Biomarkern Procalcitonin (PCT) und Interleukin 6 (IL-6) scheint ein österreichisches Forschungsteam neue Parameter zur Feststellung von periprothetischen Gelenkinfektionen bei einer Revisionsendoprothetik identifiziert zu haben. Studienleiter Prof. Mathias Glehr, Universitätsklinik Graz, fasste die Ergebnisse zusammen: „Wir haben die Sensitivität und Spezifität von konventionell genutzten Biomarkern wie C-reaktives Protein (CRP) und den Leukozyt-Spiegel jener von PCT, IL-6 und Interferon alpha (IFN-a) gegenübergestellt. CRP hat sich zwar nach wie vor als der beste Biomarker bestätigt, um bei periprothetischen Revisionsoperationen eine Infektion zu diagnostizieren, aber PCT und IL-6 haben sich ebenfalls als hilfreich erwiesen. Sie könnten als zusätzliche Indikatoren herangezogen werden, sollte eine Diagnose nicht eindeutig ausfallen.“ Für die Studie wurden die Werte von 84 Patienten beziehungsweise 124 Operationen analysiert.
Knieprothetik: Risikotreiber Lebererkrankungen und Blutkonserven
Eine US-Studie filterte Fremdbluttransfusionen und Lebererkrankungen als signifikante Risikofaktoren für eine stationäre postoperative Infektion bei Patienten heraus, die zum ersten Mal einen Knieersatz bekamen. Jüngere waren eher infektionsgefährdet als Ältere. Unter den Eingriffsarten erwiesen sich unilaterale oder stufenweise bilaterale Eingriffe als infektionsanfälliger als bilaterale Operationen, die am gleichen Tag durchgeführt wurden.
Für die Studie wurden die Daten von fast 18.000 Patienten des Hospital of Special Surgery (New York) analysiert. Bei 0,64% wurde während des Krankenhausaufenthalts eine Infektion diagnostiziert, 4% davon waren tiefe Infektionen. Bei der periprothetischen Spätinfektion war die Inzidenz mit 0,41% geringer, dafür wurden 82% dieser Infektionen als tief klassifiziert. Als unabhängige Risikofaktoren stellten sich Erkrankungen an Nieren oder Lunge heraus, weiters Wunddehiszenz oder eine vorhergehende Krankenhausinfektion. „Unsere Arbeit leistet einen Beitrag zur Identifikation besonderer Risikogruppen. Ziel muss es sein, speziell bei diesen durch angemessene Maßnahmen künftig unnötige Komplikationen zu vermeiden“, so Dr. Studienleiter Dr. Lazaros Poultsides.
Nanotechnologie könnte Orthopädie revolutionieren
„In der Nanotechnologie steckt ein großartiges Potenzial für die Orthopädie. Die entscheidende Frage ist: Wird sie den Patienten auch langfristig nicht schaden? Rigorose Prüfverfahren sind unabdingbar“, sagte Univ.-Prof. Nicola Baldini, Istituto Ortopedico Rizzoli und Universität Bologna. Eine wissenschaftliche Sitzung beschäftigte sich mit den Potenzialen und Risiken der Nanotechnologie. Nanotechnologie in der Orthopädie ist keineswegs Zukunftsmusik: „Die Nanowissenschaften dringen in viele Schlüsselbereiche des Fachgebiets vor, auch in der klinischen Praxis. Zunehmend werden Therapien erforscht, bei denen einzelne Gene oder molekulare Signalwege manipuliert werden“, berichtete der Experte. Bereits im Einsatz sind beispielsweise rekombinante Technologien, mithilfe derer humanisierte Antikörper produziert werden, um den Knochenabbau zu reduzieren. Ein Beispiel, wie Bio- und Nanotechnologie zusammenspielen können, sei das Gebiet der Exosomenwissenschaft und -technologie. Exosome sind körpereigene, subzellulare Strukturen, die von Zellen freigesetzt werden und Proteine transportieren, etwa Wachstumsfaktoren. Sie sind einerseits Informationswerkzeuge, können aber auch Zielzellen aktivieren.
Die meisten nanotechnologischen Innovationen stecken zwar noch in der Entwicklungsphase, aber es gibt viel versprechende Ansätze: Mit der Photoaktivierung von fluoreszierenden Molekülen, die mit subzellulären Nanomotoren interagieren, dürfte eine Methode gefunden worden sein, um Knochenkrebs zu behandeln. „In diesem Bereich wird fieberhaft nach Möglichkeiten gesucht, um maßgeschneiderte Therapien je nach genetischem Profil anbieten zu können. Theoretisch wäre das bereits machbar, aber die Kosten sind derzeit noch exorbitant“, so Baldini. Um biologisch aktive Substanzen genau an der Stelle zu verabreichen, an der sie auch wirken sollen, wurden Nanotransporter entwickelt, die Knochentumore ansteuern und zielgerichtet Tumorzellen mit zytotoxischen Medikamenten oder therapeutischen Molekülen angreifen sollen. „Das ist ein sehr vielversprechender Zugang, denn auf diese Weise könnte man gesundes Zellgewebe schonen“, sagte Baldini.
Nanoimaging lässt tief blicken
Die Annäherung zwischen Nanotechnologie und bildgebender Diagnostik wird in naher Zukunft völlig neue Möglichkeiten der molekularen Bildgebung eröffnen: Das Nanoimaging wird erlauben, einzelne Moleküle oder Zellen auch in einer komplexen biologischen Umgebung zu erkennen. Dazu werden beispielsweise fluoreszierende Nanokristalle wie Quantenpunkte eingesetzt. Das sind Nanopartikel, die ein spezielles Gewebe oder eine bestimmte Zelle ansteuern können, diese zum Fluoreszieren bringen und somit sichtbar machen. „Die Fachwelt setzt große Erwartungen in die Quantenpunkte, die besonders hilfreich bei der Bildgebung in lebenden Geweben sein könnten, bei denen sonst die Impulse verzerrt und Bilder unscharf werden“, berichtete Baldini.
Fester, leichter, infektionshemmend: Nanostrukturiertes Material
Auch nanostrukturiertes Material bietet zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten für die Orthopädie. Die Oberflächeneigenschaften von Implantaten etwa lassen sich so optimieren, dass sie Osteoblasten besser leiten und das Einwachsen in den Knochen begünstigen. Funktionalisierte Polymere, die die Knochenmatrix nachnahmen, könnten künftig Träger zum Züchten von Ersatzgewebe sein. Mithilfe von Nanotechnologie werden Materialien in Zukunft stärker und leichter: „Nanokohlenstoffröhrchen zum Beispiel haben die Steifigkeit eines Diamanten und sind hundertmal stärker als Stahl, obwohl sie nur ein Sechstel davon wiegen“, so Baldini. Nanostrukturierte Keramik kann Reibung und somit auch die Verschleißprobleme bei künstlichem Gelenkersatz reduzieren. Erfolgversprechende Neuerungen sind nanokristalline Silbermembrane für Wundverbände, mit denen postoperative Infektionen reduziert und Heilungsprozesse beschleunigt werden sollen. Auch zytokinhaltige Implantat-Nanobeschichtungen sollen Infektionen verhindern, indem sie Makrophagen aktivieren, die in der Immunabwehr eine entscheidende Rolle spielen.
„Bei aller Begeisterung für die neuen Möglichkeiten, gilt es allerdings zu bedenken, dass die Studien zur Überprüfung von Nanophasenmaterialien erst angelaufen sind“, unterstrich Baldini. Da Nanopartikel kleiner sind als die Poren vieler biologischer Gewebe, seien rigorose Sicherheitsüberprüfungen unerlässlich. Sie könnten sich zudem leicht von Prothesen lösen. „Die vermutlich größte mögliche Risikoquelle sind Nanomaterialien, die anorganische Metalle und Metalloxide enthalten. Nanopartikel sind hochgradig reaktiv und könnten bislang unbekannte chemische Reaktionen auslösen“, gab der Experte zu bedenken. Zudem hat sich gezeigt, dass der Metabolismus von Nanopartikeln auf verschiedene Organsysteme wirken kann, einschließlich Blut, Leber und Nieren, was möglicherweise für Entzündungen und oxidativen Stress sorgt. Nanopartikelabrieb hat ungewisse lokale Gewebeeffekte und wurde mit Lungen- und Gehirntoxizität in Verbindung gebracht. „Ungeachtet der großen Potenziale und der führenden Rolle Europas in der Weiterentwicklung dieses Zukunftsbereichs wird alles damit stehen und fallen, ob wir die möglichen Langzeitfolgen von nanotechnologischen Produkten einzuschätzen lernen. Und in einem so innovativen Gebiet ist ein interdisziplinärer Zugang entscheidend“, meinte Baldini.