Alltagseinschränkungen als Alarmzeichen
Während akute Schmerzen eine überlebenswichtige Funktion haben, verlieren chronische Schmerzen diese Funktionalität. Halten Schmerzen etwa nach Abheilung einer akuten Verletzung andauernd oder wiederkehrend über 3 Monate an, spricht man von chronischen Schmerzen. Dies ist die Transition vom Symptom zur eigenständigen Erkrankung. Die Häufigkeit von chronischen Schmerzen im Kindes- und Jugendalter ist mit jener im Erwachsenenalter vergleichbar. So leidet zirka ein Viertel der Kinder und Jugendlichen (8–17 Jahre) unter chronischen Schmerzen. Etwa 5 % der Kinder und Jugendlichen leiden unter derart starken Schmerzen, dass diese zu Alltags- und Lebensbeeinträchtigungen führen. Das bedeutet, diese Kinder können nicht oder nur eingeschränkt die Schule besuchen oder Freizeitaktivitäten nachgehen. Das kann so weit gehen, dass eine Teilhabe am normalen Leben nicht mehr möglich ist. Die damit verbundene Belastung auf psychischer Ebene ist in der Regel immer mitvorhanden.
Transition zum chronischen Schmerz
Erfolgt eine Verletzung, leiten Nozizeptoren die Information Schmerz über das Hinterhorn des Rückenmarks und Synapsen zum Gehirn. Über die absteigende Schmerzbahn werden Schmerzsignale gehemmt. Sollte dieser Ausgleich nicht mehr gegeben sein, entstehen neue, ausgebaute Netzwerke im Gehirn, die dazu führen, dass die Information „Schmerz“ verbessert fließen kann. Nach rezidivierenden Schmerzerfahrungen und bei sensibilisiertem Nervensystem kann die Information „Schmerz“ auch ohne nozizeptive Aktivierung wahrgenommen werden. Dann reicht z. B. bereits eine negative Lebenserfahrung, um Schmerzen zu empfinden. Der chronische Schmerz ist also eine Lernerfahrung, die sich durch biologische und psychologische Prozesse erklären lässt und aus der Plastizität des Zentralnervensystems resultiert.
Häufig und insbesondere bei höherem Chronifizierungsgrad geben Kinder und Jugendliche mehrere Schmerzorte an. Die Schmerzlokalisation und -intensität kann sich auch im Laufe der Zeit verändern und ist nicht als statisches Geschehen zu werten. So leiden jüngere Kindern vermehrt an Bauchschmerzen, während ältere Kinder und Jugendliche vorwiegend Kopfschmerzen und muskuloskelettale Schmerzen angeben. Mädchen sind häufiger betroffen – warum, ist derzeit noch unklar.
Ein steiniger Diagnoseweg
Die meisten Kinder, die einer chronischen Schmerzstörung unterliegen, brachten bereits mehrfache ärztliche Besuche, diagnostische Untersuchungen, Blutabnahmen und ggf. interventionelle Verfahren hinter sich. In aller Regel führte die bisher erfolgte medizinische Abklärung zu keinem wegweisenden Befund, und die unimodale Schmerztherapie (Medikamente, ggf. Operationen etc.) brachte keinen Erfolg. Letztendlich berichten auch viele Kinder von Konflikten mit Behandlern. Es wird die Glaubwürdigkeit der Kinder in Zweifel gestellt, und sie werden als Simulanten dargestellt, die den Schulbesuch vermeiden wollen würden. Dies führt letztlich zu einer enormen Frustration der Kinder sowie von deren Familien.
Typischerweise beginnt eine chronische Schmerzstörung mit einem „besonderen“, oft somatischen Ereignis. Im Fallbeispiel von Maria war es der Schulunfall bzw. der harte Ballschuss auf den Kopf. Der weitere Weg zeigt, dass es auch wichtig ist, somatisch eindeutige Befunde auszuschließen, um sich auf eine Schmerzstörung festlegen zu können. Gleichzeitig sollte jedoch keine „Überdiagnostik“ betrieben werden. Der durchschnittliche chronische Schmerzpatient bringt Laborbefunde im zweistelligen Bereich und mehrfache Bildgebungen (wiederholte MRT-Untersuchungen, Röntgen, Ultraschall) mit nichtwegweisenden Ergebnissen.
Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie
Um die Komplexität von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Schmerzen zu verstehen, bedarf es eines multimodalen Ansatzes – eines koordinierten Vorgehens von verschiedene Fachdisziplinen, die gemeinsam ein bestmögliches Ergebnis für die Patienten erzielen. Darüber hinaus ist es wichtig, die Patienten über intensive Schulung zu „Schmerzexperten“ zu machen. Zudem muss projiziert werden, dass zurückgezogenes, passives Verhalten zu einer Verschlimmerung der Schmerzerkrankung führt. Das Ziel ist, die Kinder und die Jugendlichen dahingehend zu fördern, dass sie selbst etwas gegen die Schmerzen tun und ihr Leben somit wieder selbstwirksam gestalten können. Die Negativspirale muss durchbrochen und das Schmerzgedächtnis zurückgebildet werden. Die Plastizität von neurogenen Strukturen lässt es zu, dass eine Schmerztherapie bei Kindern und Jugendlichen sehr erfolgversprechend ist.
Versorgung in Österreich mangelhaft
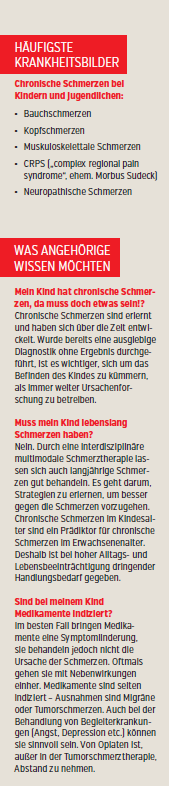 Im Gegensatz zu Deutschland – mit stationären Kinderschmerzzentren in mehreren Städten – gibt es in Österreich keine einzige Institution, die ein solches multimodales Programm stationär anbietet, und auch die ambulanten Angebote sind hierzulande vergleichsweise rar gesät.
Im Gegensatz zu Deutschland – mit stationären Kinderschmerzzentren in mehreren Städten – gibt es in Österreich keine einzige Institution, die ein solches multimodales Programm stationär anbietet, und auch die ambulanten Angebote sind hierzulande vergleichsweise rar gesät.
Ein wichtiges Instrument in der multimodalen Schmerztherapie ist die psychotherapeutische Mitbehandlung. Es gilt als gesichert, dass vorbestehende psychische Komorbiditäten (häufig Angst oder Depression, aber auch Teilleistungsstörungen, Störungen von Aktivität und Aufmerksamkeit, PTBS) das Entstehen einer Schmerzerkrankung fördern. Zudem gelten vor allem Angst oder Depression häufig als über die Zeit schmerzaufrechterhaltende Faktoren. Bei der Therapie kommen unterschiedlichste Instrumente zum Einsatz: Verhaltenstherapie, Einzel- und Gruppentherapie, Biofeedback, Entspannungsverfahren, EMDR etc. Ergänzend können Tierpädagogik, Yoga, Meditation, Qigong, Thai-Chi oder ähnliche Verfahren eingesetzt werden.
Auch das familiäre Umfeld soll bestmöglich miteinbezogen werden. Die Eltern spielen bei der Behandlung eine Schlüsselrolle und sind oftmals Garanten, dass eine Schmerztherapie im Alltag erfolgreich umgesetzt wird. Familien sollten nach einem Aufenthalt so normal wie möglich leben und stützend für die betroffenen Kinder wirken. Der Schulbesuch soll wahrgenommen werden, und negative Einflussfaktoren sollen minimiert werden. Sehr wichtig ist eine schmerzunabhängige Zuwendung, damit das menschliche „Belohnungssystem“ nicht aktiviert wird und Drucksituationen vermieden werden.
Am Beispiel von Maria sieht man, dass es einen intensiven Austausch zwischen Patienten, Eltern und Therapeuten sowie einiges an Zeit und Vertrauen braucht, um die verursachenden Umstände verstehen zu können. Unimodale Ansätze sind bei akutem Schmerz sehr wichtig und indiziert. Bei Kindern und Jugendlichen mit chronischen Schmerzen sind diese Ansätze hingegen nicht erfolgversprechend. Ein Schmerzmittel lindert unter Umständen die Symptome, verändert aber nichts an der Erkrankung. In der Regel, mit Ausnahme der Migräne, berichten Kinder und Jugendliche mit chronischen Schmerzen, dass Medikamente einerseits nicht wirken und die Nebenwirkungen andererseits beträchtlich sind (z. B. Pregabalin, Gabapentin etc.).
Fazit
Chronische Schmerzen sind nach dem biopsychosozialen Schmerzmodell zu behandeln. Mit einem koordinierten interdisziplinären multimodalen Ansatz werden wir der Vielschichtigkeit und Komplexität der Erkrankung gerecht und haben gute Chancen, einen Prozess zu starten, der die Kinder und Jugendlichen wirkungsvoll stärkt und ihnen Lebensqualität zurückgibt.























































































