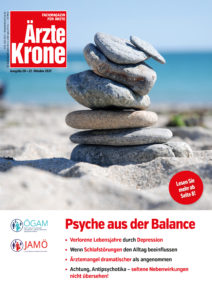Herausforderung Depression: Nicht nur in der Pandemie!
„Ich bin depressiv.“ Dieser Satz kam in den vergangenen Jahren immer häufiger von Patienten – beim genaueren Nachfragen werden sehr unterschiedliche Symptome geschildert: depressive Verstimmung, Trauer, Burn-out, Panik, Ängste, Erschöpfung und jetzt die Folgen der Pandemie stehen alle gemeinsam unter der Überschrift: „Depression“.
Während der Pandemie zeigte sich sehr deutlich, dass depressive Krankheitsbilder zu einem wesentlichen Teil von exogenen Faktoren getriggert werden. Quarantäne, Homeoffice und Homeschooling haben zu einer enormen Zunahme der Belastung aller Familienmitglieder geführt, wobei der Anstieg depressiv-ängstlicher Symptome vor allem bei Kindern groß war und ist.
Ebenfalls deutlich wurde in Studien, dass Familien mit einem geringeren sozioökonomischen Status stärker betroffen sind und weniger Unterstützungsangebote kennen und/oder sich leisten können. Nach einer sinnvollen Phase der Soforthilfe besteht die Sorge, dass einerseits die Hilfsangebote wieder zurückgefahren werden und dass andererseits die Folgen der belastenden Faktoren, wie bei fast jeder traumatischen Störung im psychiatrischen Kontext, verzögert auftreten. Präventiv zu arbeiten, vor allem für die Jüngeren, ist hier die große Aufgabe.
- Depression und andere psychische Erkrankungen
- Krebserkrankungen
- legaler und illegaler Suchtmittelabusus
- alleinstehend
- vorangegangene Suizidversuche
- chronische Schmerzen
Die WHO hält depressive Erkrankungen schon vor der Pandemie für eine der häufigsten und folgenschwersten psychiatrischen Störungen, sowohl für die betroffenen Menschen selbst als auch in Bezug auf ihre volkswirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Aspekte. 1993 wurde das Konzept der „global burden of disease“ mit mehreren Betrachtungskriterien entwickelt. „Vorzeitiger Tod durch eine Erkrankung“, „Jahre, die mit einer Behinderung durch eine Krankheit gelebt werden und daraus abgeleitet die Anzahl der ‚verlorener, Lebensjahre‘“. Depressionen stehen dabei noch vor Herz-Kreislauf-, Muskel- und Skelett- und Infektionskrankheiten an erster Stelle!
Diagnose: Depression
Psychische Gesundheit ist kein kontinuierlicher Zustand, sondern Schwankungen unterworfen in einem Leben, das eben auch mit Sorgen, Belastungen und Schwierigkeiten einhergeht. Im Volksmund wird schnell einmal ein bedrückter, belasteter, ermüdeter oder erschöpfter Zustand als depressives Geschehen bezeichnet. Jedoch soll man erst dann von einer Erkrankung sprechen, wenn durch diese Problematiken unser Alltag ernst- und dauerhaft behindert und erheblich eingeschränkt wird.
Eine ausführliche Anamnese auf den psychosozialen Achsen (persönlich, Umfeld, Arbeit, Ressourcen) dient nicht nur zur fachlichen Beurteilung der geschilderten Symptome, sondern stellt auch den Anfang einer Beziehungsgestaltung dar, die vor allem für einen längeren Behandlungsverlauf von größter Bedeutung ist – dieser ist in den meisten Fällen indiziert. Aufklärung und das Erstellen eines Behandlungsplans sind sowohl für die Betroffenen als auch das familiäre und soziale Umfeld von großer Bedeutung. Sowohl die medikamentösen Strategien als auch die Psychotherapie benötigen einige Zeit, um Veränderungen zu bewirken. Ein Notfallplan hilft, Krisen im Behandlungsverlauf bewältigbarer zu machen. In allen Fällen muss nach suizidalen Gedanken und Entwicklungen gefragt werden.
Hausärztinnen und Hausärzte sind zumeist die ersten, die mit Symptomen einer Depression konfrontiert werden – und behandeln sie üblicherweise auch. Im Laufe einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung sollten immer auch Fachärzte für Psychiatrie miteinbezogen werden.
Der Ausschluss von Erkrankungen anderer Organsysteme würde wahrscheinlich nicht viel an der psychiatrischen Behandlungsstrategie ändern, allerdings wäre das Nichtbehandeln ursächlicher Erkrankungen ein schwerer Fehler. Zu diesen zählen unter anderem endokrine Störungen, Krebserkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, andere psychiatrische Erkrankungen, Substanzabusus, Alter/Demenz, Medikamente, Traumata und chronische Schmerzen.
Behandlung im Doppelpack
Ist man zu der Meinung gekommen, dass es sich um ein depressives Krankheitsgeschehen handelt, stehen sehr verschiedene Behandlungsansätze zur Verfügung. Die zwei Hauptpfeiler der Behandlungsstrategie sind dabei die medikamentöse Behandlung und die Psychotherapie. Die Kombination beider ist allen Studien zufolge die erfolgversprechendste Unterstützung, um wieder gesund zu werden. Sport, Veränderung der Lebensführung, Erlernen von Techniken zur Entspannung und Distanzierung, eine Umstellung der Ernährung (Darm-Hirn-Achse) gehören ebenfalls zu den wirksamen Interventionen. Und Geduld!
Ein großer Anteil depressiver Erkrankungsbilder ist durch diese Therapiemöglichkeiten sehr gut behandelbar. Die Verläufe können akut, rezidivierend, aber auch chronisch sein – und gar nicht so selten ist man mit einer therapieresistenten Verlaufsform konfrontiert. In diesen Fällen ist besonders achtsam auf Komorbiditäten, Medikamenteninteraktivitäten und Lebensgewohnheiten zu achten. Rauchen beispielsweise kann Medikamentenspiegel um ein Vielfaches reduzieren. Eine partizipative Entscheidungsfindung bezüglich der Therapieoptionen ist anzustreben.
Medikamentöse Strategien zielen auf die Beeinflussung der Neurotransmittersituation in der Informationsübertragung zwischen den einzelnen Nervenzellen ab. In bildgebenden Untersuchungen konnte überdies gezeigt werden, dass Psychotherapie ebenfalls auf diese Prozesse in der Informationsübertragung wirkt.
Eine Substanzgruppe der verordneten Antidepressiva hemmt die Serotoninwiederaufnahme im synaptischen Spalt (Therapie der ersten Wahl). Des Weiteren kommen SSNR (Serotonin-/Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer), Alpha2-Rezeptoranatgonisten, 5HT2-Rezeptorantagonisten (auch in Kombination mit Serotonin-Wiederaufnahmehemmern) und selektive Hemmer der Noradrenalin- und Dopaminwiederaufnahme zur Anwendung. Auch die Antidepressiva der ersten Generation Tri- und Tetrazyklika bzw. Monoaminoxidase-Hemmer sind noch in Verwendung, wobei hier ein sehr enges Monitoring hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen angezeigt ist.
Weitere Behandlungsstrategien
Die Verwendung von Ketamin, einem Narkose- und Schmerzmittel, soll eine sehr rasche Besserung von schweren depressiven Zustandsbildern bewirken und ist derzeit hauptsächlich im stationären Bereich in Verwendung.
Forschungen beschäftigen sich in den letzten Jahren auch vermehrt mit pflanzlichen Substanzen. Johanniskraut hat dabei schon einen bewährten Platz vor allem bei leichteren Verlaufsformen und bei Unverträglichkeiten mit synthetischen Produkten eingenommen. Neuerdings wird Psylocybin (der psychotrop wirksame Bestandteil in Pilzen) und seine antidepressive Potenz beforscht.
Ein spannender Ansatz ist auch die Frage, ob und wie unsere Ernährung und folglich die Zusammensetzung des Mikrobioms bei der Entwicklung depressiver Störungen relevant ist. Hier gehen die Überlegungen davon aus, dass Stoffe, die bei einer nicht ausreichend ausgebildeten Darmflora in den Organismus gelangen, dann zumeist über Oxidationsprozesse Zellschädigungen hervorrufen. Postuliert wird hier ein negativer Einfluss auf Gliazellen.
Altbewährt ist ohne Zweifel Lithium. Es findet seit Jahrzehnten Verwendung in der Behandlung von unipolaren Depressionen sowie als Stimmungsstabilisator bei bipolaren Störungen. (Cave: regelmäßige Spiegelbestimmung, auf die Flüssigkeitszufuhr und Schwitzen achten)
Bei einem mangelnden Therapieerfolg ebenso wie bei dem Auftreten von psychotischen Symptomen (Wahnideen, Halluzinationen, Stupor) muss auch an die Augmentation der laufenden antidepressiven Medikation durch moderne Antipsychotika gedacht werden.
- „Depression ist die Krankheit der ‚…losigkeit‘ – freudlos, kraftlos, energielos, lustlos, interessenlos, appetitlos, antriebslos, wertlos, perspektivenlos.“
- Eine somatische Abklärung der Symptome ist unbedingt notwendig!
- Die Kombination von medikamentöser und Psychotherapie ist die erfolgversprechendste Strategie.
- Bezüglich der Therapieoptionen ist eine partizipative Entscheidungsfindung anzustreben.
Nach der Depression
Nach längeren depressiven Episoden mit deutlichen Funktions- und Teilhabestörungen sind zur Wiedereingliederung von Patienten in das Berufsleben Maßnahmen wie längerfristige, begleitende psychotherapeutische Behandlung, Ergotherapie, Aufenthalt in einem Rehabilitationszentrum, Angebote von Angehörigenberatungsorganisationen, Selbsthilfegruppen sowie Peer-Beratung hilfreich.
Je nach Ursache soll auch der Prozess der Reduktion der Medikamentendosis, das Ausschleichen der Medikation bzw. eine reduzierte Frequenz der Psychotherapie oder deren Beenden begleitet und observiert werden. Die Neigung zu einer erneuten Exazerbation depressiver Symptome ist nicht auszuschließen, und die regelmäßige Verlaufskontrolle bietet eine sehr gute Möglichkeit, Schwankungen frühzeitig entgegenzusteuern und den Therapieerfolg nicht zu gefährden. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist für diese Situation eine Grundvoraussetzung.