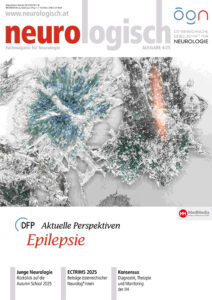Ein Kardinalsymptom der Demenz oder neurokognitiven Störung sind Schwierigkeiten bei der Durchführung von Alltagsaktivitäten. Die Fertigkeiten der Person verändern sich und passen nicht mehr mit den Anforderungen der Umwelt und mit den Aktivitäten zusammen. Das ist für viele Menschen, die eine Demenz-Diagnose erhalten, ein schmerzhafter Prozess, der Unterstützung benötigt.
Frühzeitige Diagnose
Ein wichtiger Baustein erfolgreicher Anpassung an das Leben mit kognitiver Einschränkung ist die recht- und v.a. frühzeitige Diagnosestellung. Hier spielen Ärzt:innen im Akutbereich, aber besonders auch im extramuralen Raum eine wesentliche Rolle. Wenn keine Diagnose gestellt wird, erhalten die Personen auch keinen Zugang bzw. keine Möglichkeit zu Unterstützungsleistungen. Neben der Eigenanamnese gehört bei der Demenzdiagnostik auch immer eine Fremdanamnese dazu. Hier sollte immer zuerst mit der betroffenen Person gesprochen werden und diese in den Mittelpunkt der Kommunikation gestellt werden. Zur weiteren Abklärung gehören Blutuntersuchungen und eine Bildgebung des Gehirns. Dies geschieht, um mögliche reversible Ursachen für Vergesslichkeit auszuschließen. Zusätzlich wird eine klinisch-psychologische Testung durchgeführt. Wichtig zu wissen für Patient:innen ist, dass diese Testung nach 6 Monaten wiederholt wird. Erst bei wiederholt bestätigter eingeschränkter kognitiver Leistung darf die Diagnose Demenz gestellt werden.
Bereits im Rahmen der Diagnostik soll Unterstützung angeboten werden. Ärzt:innen sind oft die ersten Ansprechpartner:innen für Information zu Selbsthilfegruppen, Alltagsbegleitung, Hilfsdiensten oder auch psychologischer Begleitung. Ein offener Umgang mit der Diagnose kann helfen, dass sich das soziale Umfeld auf die Veränderungen der Fertigkeiten der Person einstellen kann – das kann für pflegende Angehörige den Umgang mit den hohen Anforderungen der Betreuung zu Hause erleichtern.
Wertschätzende Kommunikation
Durch einen wertschätzenden Umgang mit Menschen mit Demenz können diese länger am normalen Alltag teilnehmen und zeigen auch weniger auffällige Verhaltensweisen wie Aggression, Verkennungen oder auch Weggehtendenzen.
Prinzipiell gelten dieselben Grundregeln wie für jede gute Kommunikation. Sprechen Sie Personen von vorne und auf Augenhöhe an. Ein langsames Sprechtempo und einfache Worte helfen Menschen mit kognitiven Einschränkungen, das Gesagte zu verstehen. Fachvokabular sollte vermieden werden. Sprechpausen können dazu beitragen, dass das Gesagte auch verstanden wird. Schreien sollte auch bei schwerhörigen Menschen vermieden werden. Dieses kann als unhöflich empfunden werden und im schlimmsten Fall ablehnendes Verhalten auslösen.
Pro Satz sollte nur eine Mitteilung gegeben werden. Entweder-oder-Fragen überfordern oft. Günstig sind offene Fragen, bei denen nicht zwingend konkrete Antworten gegeben werden müssen. Fragen, die konkrete Antworten erfordern, wie z.B. „Was haben Sie heute zu Mittag gegessen?“, schaffen Stress, Schamgefühl und Frust. Besser wäre im oben genannten Beispiel die offene Frage: „Wie schmeckt Ihnen das Essen hier?“ Sollten auch offene Fragen bereits überfordern, sind Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, günstig. Wichtige, vom Gegenüber eingebrachte Themen sollten wiederholt und ihre Wichtigkeit bestätigt werden. Menschen mit Demenz können auf Wissen und Lebenserfahrungen aus ihrer Vergangenheit zurückgreifen. Sogenannte Damals-und-dort- Fragen können das Selbstwertgefühl von Menschen mit Demenz stärken.
Psychosoziale Interventionen
Angehörige von Menschen mit kognitiver Einschränkung brauchen Unterstützung und konkrete Hilfe dabei, wie sie ihre Angehörigen mit Demenz bei Aktivitäten des täglichen Lebens unterstützen und anleiten können, ohne alles aus ihrer Hand zu geben. Viele der psychosozialen Interventionen (sog. nicht-medikamentöse Interventionen) für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen, die in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt wurden, beinhalten Kommunikationstrainings daher als einen wichtigen Baustein.
Eine wichtige psychosoziale Intervention liefert der ergotherapeutische Ansatz. Viele Angehörige von Menschen mit Demenz, die in die Rolle der betreuenden und pflegenden Angehörigen „hineinrutschen“, wissen nicht, wie sie ihre Angehörigen mit einer Demenz erfolgreich dabei unterstützen können, diverse Aktivitäten durchzuführen. Das kann dazu führen, dass Konflikte entstehen, die aus Überforderung auf der einen Seite und dem Verlust von Rollen und wertgeschätzten Aktivitäten auf der anderen Seite Zündstoff liefern. Hier setzt die Ergotherapie an: Nach einer individuellen Befunderhebung werden gemeinsam Strategien entwickelt, wie Aktivitäten trotz Demenz durchgeführt werden können, beispielsweise mit Anpassungen im Umfeld wie Beschilderungen, tagesstrukturierende Maßnahmen wie ein gemeinsamer Kalender, Training, aber eben auch Schulungen für Angehörige, wie sie besser helfen können: beim Anziehen oder bei gemeinsamen Aktivitäten.