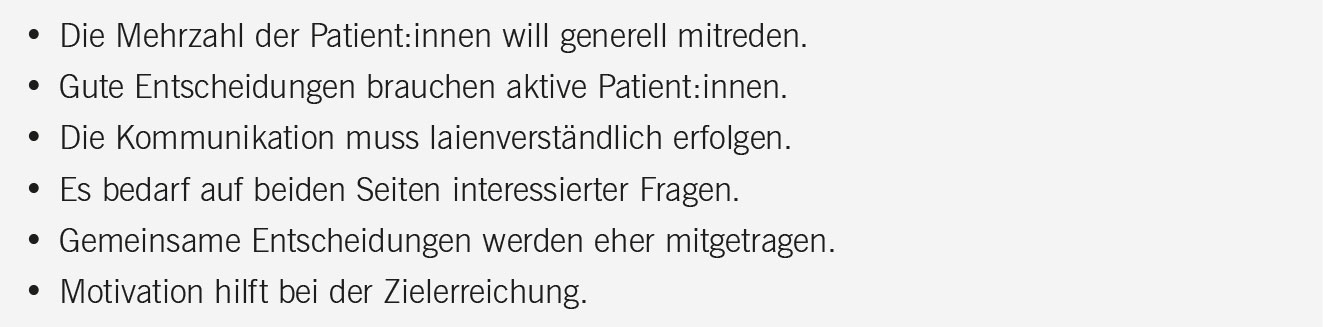Wir Patient:innen wollen mitreden!
Kommunikation ist nicht nur Faktenvermittlung. Kommunikation macht auch viel mit unserer Gefühlswelt. Sie kann einen Anker im Kopf der Patient:innen setzen – sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Als Brustkrebspatientin mit Metastasen in Leber, Knochen und Bauchfell habe ich das in den 9 Jahren seit meiner Diagnose am eigenen Leib erfahren. Kommunikation kann – im besten Fall – informieren, motivieren und einen gemeinsamen Weg ebnen.
Shared Decision-Making
Im Arzt:Ärztin-Patient:in-Gespräch ist ein Shared Decision-Making bedeutsam. Übersetzt man diesen Terminus wörtlich, ergibt sich die „partizipative Entscheidungsfindung“ – zwar ein herausforderndes Wortkonstrukt, aber eine sinnvolle Strategie zur Lösungsentwicklung. Doch was ist damit eigentlich gemeint? Im Gespräch wird die vorgeschlagene Behandlung ausführlich und laienverständlich thematisiert. Es soll dabei auf die Vorteile, Risiken und Nebenwirkungen eingegangen werden. Fragen sind hierbei natürlich allseits ausdrücklich willkommen. Das transportierte Wissen über den Krankheitsverlauf und die Therapiemöglichkeiten erleichtert es den Patient:innen, gemeinsame Entscheidungen über weitere Schritte treffen zu können.1 Die Betroffenen fühlen sich dort abgeholt, wo sie stehen und tragen die Maßnahmen auch besser mit. Es geht für Patient:innen nicht darum, in Rekordzeit ein Medizinstudium zu absolvieren, sondern einfach darum, Basiswissen vermittelt zu bekommen, um eine realistische Einschätzung vornehmen zu können. Wünschenswert ist dabei ein Gespräch auf Augen- und Herzenshöhe. Der Zusatz Herzenshöhe ist mir wichtig – gerade im Hinblick auf das Pflegepersonal, das meist am nächsten an den Patient:innen arbeitet, viel Zeit investiert und häufig ein enormes Maß an Empathie mitbringt.
Patientenwünsche ans onkologische Team
Als chronische Onkologie-Patient:innen sind wir froh und dankbar, dass es Menschen aus der Pflege gibt, die uns auf unserem schwierigen Weg mit fundiertem Fachwissen und großem Verständnis begleiten. Was aus Patientensicht die Wünsche an das onkologische Team seien, werde ich immer wieder gefragt. Hier eine kurze Zusammenfassung aus meiner Perspektive:
- Vorbereitung auf die Konsultation: Patient:innen freuen sich, wenn das medizinische Team „vorbereitet“ ist, die letzten Befunde kennt und sie nicht wieder die gesamte Krankengeschichte erzählen müssen.
- Gespräch auf Augen- und Herzenshöhe: Es braucht bei einem sensiblen Thema, wie der eigenen Krebserkrankung, einfach eine offene und ehrliche Gesprächskultur auf Augen- und Herzenshöhe. Am besten mit genug Zeit, Interesse und Empathie.
- Aktives Zuhören und Fragen stellen: Kommunikation darf keine Einbahnstraße sein. Was es braucht, ist ein aktives Zuhören, ohne die Gesprächspartner:innen ständig zu unterbrechen. Studien belegen, dass Ärzt:innen ihre Patient:innen nach 11 bis 24 Sekunden das erste Mal unterbrechen. Patient:innen sollen loswerden dürfen, was ihnen am Herzen liegt, erst dann kann es mit Detailfragen weitergehen.
- Informationen in patientengerechter Sprache: Im Gespräch zwischen Patient:innen und dem medizinischen Team bedarf es einer gemeinsamen Sprache, die für beide gleichermaßen verständlich ist. Patient:innen brauchen – gerade bei einem komplexen onkologischen Thema– laiengerechte, verständliche Erklärungen.
- Shared Decision-Making: Den meisten Patient:innen geht es darum, Kapitän:in des eigenen Bootes zu bleiben. Dafür sind fachkundige, schlüssige Erklärungen notwendig, auf Basis welcher eine gemeinsame Therapieentscheidung getroffen werden kann. Im Mittelpunkt sollten – neben dem Therapieansprechen – größtmögliche Lebensqualität, persönliche Balance und realistische Ziele stehen.
- Schaffung von Perspektiven: Breaking Bad News ist eine große Herausforderung – besonders wenn Patient:innen mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert sind. Dennoch geht es aber auch darum, sich kleine Ziele zu setzen. Es tut gut, erreichbare Perspektiven aufgezeigt zu bekommen, Motivation zu erhalten und von Mutmacher:innen zu hören.
Adhärenz und das „Verhandeln“ eines Therapiekonzepts
Adhärenz beschreibt in der Medizin die „Therapietreue“. Ihr liegt ein Behandlungsplan zugrunde, den sowohl Ärzt:in als auch Patient:in gemeinsam erstellt haben. Folglich tragen beide Seiten maßgeblich zur Adhärenz bei. Diese spielt vor allem für die Therapie chronischer Erkrankungen – wie eben Krebs – eine entscheidende Rolle. Und beinhaltet natürlich auch die wichtige Arbeit der Pflege.2 Was soll das in einfacheren Worten heißen? Patient:innen sind den Entscheidungen der Ärzteschaft nicht „ausgeliefert“, es wird ihnen nichts „übergestülpt“, sondern beide Seiten „verhandeln“ das beste Therapiekonzept aus. Patient:innen sind eingeladen, aktiv über ihren Weg mitzubestimmen. Dieses Miteinbeziehen soll sie dazu animieren, eher/besser an der Therapie festzuhalten, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Wir haben quasi zwei „Parteien“, die zum Gelingen beitragen.3
Was leisten die Patient:innen?
- Korrekte Einnahme der Medikamente: Wann, wie, womit? Hier gilt es abzuklären, welches Vorwissen über die Medikation vorhanden ist.
- Tracken der Nebenwirkungen: Wie sieht es mit der Zufriedenheit der Medikation aus? Kommt es z.B. zu Durchfall oder Hautausschlag? Womit kann man langfristig für Linderung sorgen?
- Vermeidung von Wechselwirkungen: Viele Patient:innen wissen beispielsweise immer noch nicht, dass der gesunde, vitaminreiche Grapefruitsaft am Morgen zu Wechselwirkungen mit Krebsmedikamenten führen kann; hier braucht es detaillierte Informationen.
- Einhaltung bestimmter Vorgaben: Hierzu zählen z.B. Ernährung, Sport und Bettruhe.
Was leistet das medizinische Team?
- Gründliche Therapie-Information: Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, über die Behandlung und die einzelnen Schritte informiert zu sein.
- Klärung von Unsicherheiten: Sollte es Bedenken geben, so müssen diese vor dem Therapiestart aus der Welt geschafft werden.
- Abbau von Ängsten: Plagen die Patient:innen Sorgen und Ängste, können die Ärzt:innen diese möglicherweise durch Zusatzinformationen ausräumen.
- Motivation zur Zielerreichung: Motivation ist einer der wichtigsten Begriffe überhaupt im Rahmen der Therapiefortführung.
Mangelnde Adhärenz: Im Behandlungsverlauf geht es dann darum, sich regelmäßig abzusprechen, die Therapie zu überwachen und etwaige Probleme frühzeitig zu erkennen. Bei Krebs-Patient:innen ist durchaus auch mangelnde Adhärenz zu beobachten. Ich erinnere beispielsweise nur an die Einnahme der Antihormontherapie im frühen Brustkrebsstadium. Eine Studie belegt, dass jede zweite Frau angab, dass sie aus Vergesslichkeit oder mit Absicht Tabletten nicht eingenommen hatte – was ein erhebliches Risiko mit sich bringt. Wie ich aus meiner eigenen Meta-Mädels-Community weiß, ist die Therapietreue unter metastasierten Patient:innen natürlich – angesichts der Schwere der Erkrankung – eine weitaus höhere.
Krebserkrankung als Achterbahnfahrt
Krebs ist wie eine Achterbahnfahrt. Mal rast man rasant in die Tiefe, mal geht es wieder steil bergauf. Und man weiß nie, was kommt. Man versucht, die Balance zu halten – das gelingt aber oft nicht allein. Und deshalb brauchen wir fachkundige, verlässliche Partner:innen aus der onkologischen Pflege an unserer Seite, die uns ihre Hilfe anbieten. Und: Wir wollen mitreden und mitentscheiden!