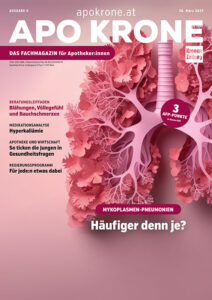HWI-bezogene Studien verwenden bislang teils unterschiedliche Bezeichnungen. Die Leitlinie von 2024 gibt Definitionen zur Vereinheitlichung an. Am häufigsten treten unkomplizierte HWI auf. Sie liegen vor, wenn im Harntrakt keine relevanten funktionellen oder anatomischen Anomalien, keine relevanten Nierenfunktionsstörungen und keine relevanten Begleiterkrankungen/Differenzialdiagnosen vorliegen. Bei einer Zystitis ist der untere, bei einer Pyelonephritis der obere Harntrakt infiziert. Zu den akuten Symptomen zählen Algurie, imperativer Harndrang, Pollakisurie und Schmerzen oberhalb der Symphyse. Bei einer Pyelonephritis kommen zusätzlich Flankenschmerz, ein klopfschmerzhaftes Nierenlager und/oder Fieber über 38°C vor. Von rezidivierenden HWI wird dann gesprochen, wenn ≥2 symptomatische Episoden innerhalb eines halben Jahres oder ≥3 symptomatische Episoden innerhalb eines Jahres vorliegen.
Komplizierende Faktoren von HWI werden aufgegliedert in angeborene oder erworbene anatomische sowie funktionelle Veränderungen und sind äußerst umfangreich. Sie reichen von Ureterabgangsstenosen über Nierensteine oder Harnleiterstrikturen bis zu Niereninsuffizienz, HIV oder dem Vorliegen eines Blasenkatheters.
Geschlechtsspezifische Unterschiede
Während der Schwangerschaft treten HWI gehäuft auf. Durch die höhere Nierendurchblutung und glomeruläre Filtrationsrate wird der Urin verdünnt, und keimreduzierende Stoffe werden reduziert.
In der Postmenopause reduziert sich die Östrogenproduktion. Damit einher geht die Atrophie der vaginalen Schleimhäute, eine Änderung des pH-Wertes und eine verminderte Laktobazillenzahl. Diese Kombination führt zu einem erhöhten Vorkommen von Erregern und somit auch Infekten. In Deutschland sind jährlich fast 20 % der Frauen zwischen 55 und 94 Jahren betroffen. Auch bei ihnen ist eine asymptomatische Bakteriurie ohne Begleiterkrankung nicht zu behandeln.
Aufgrund der größeren Entfernung zwischen Harnröhre und Anus, einer längeren Harnröhre und der antibakteriellen Wirkung des Prostatasekrets sind junge Männer die am seltensten von HWI betroffene Gruppe. Geschlechtsverkehr mit einer infizierten Frau, Analverkehr oder Vorhautveränderungen tragen jedoch zum Infektionsrisiko bei. Bei ihnen werden alle HWI, auch ohne das Vorliegen relevanter Begleiterkrankungen, aufgrund der möglicherweise ebenfalls betroffenen Prostata, als kompliziert angesehen.
Therapiealternativen
Die Leitlinien betonen das kritische Hinterfragen einer Antibiotikatherapie zur Vermeidung von Resistenzbildungen. So soll bei nichtgeriatrischen Patient:innen beim Vorliegen einer akuten unkomplizierten Zystitis eine Alternativbehandlung erwogen und mit den Patient:innen besprochen werden.
Zu den nichtantibiotischen Therapien zählen NSAR (Ibuprofen oder Diclofenac) sowie D-Mannose, Bärentraubenblätter (Uvae ursi folium) und BNO 1045 zur Bekämpfung der Erreger.
Die Leitlinie hebt die Anwendung von Cranberrys (Vaccinii macrocarpi fructus) und Mannose zum Schutz vor bakterieller Adhäsion hervor. Sie kommen vor allem zur Prophylaxe bei rezidivierenden HWI zum Einsatz. Auch pflanzliche Harnwegsdesinfizienzien werden genannt. Darunter fallen etwa die Meerrettichwurzel (Armoraciae radix), das Kapuzinerkressekraut (Tropaeoli herba), Bärentraubenblätter oder Birkenblätter (Betulae folium). Birkenblätter, Brennnesselkraut (Urticae herba) und Liebstöckelwurzel (Levistici radix) haben eine diuretische Wirkung. Mit der Anwendung von Phytopharmaka können Antibiotikatherapie und damit verbundene Resistenzbildungen reduziert werden.