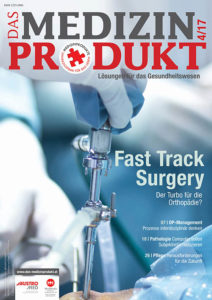Diagnose und Therapie von Prostataerkrankungen
Da Prostatakrebs im Anfangsstadium keine Beschwerden verursacht, bleiben Tumoren der Prostata meist lange unbemerkt und werden ohne Vorsorge oft erst sehr spät erkannt. Eine möglichst frühe Diagnose kann die Behandlungsergebnisse durch individualisierte und zielgerichtete Therapie stark verbessern. Die Biopsie der Prostata und die histologische Charakterisierung stellen die Grundlage und Voraussetzung für die Risikoeinschätzung, die Therapie und das Patientenmanagement bei einem Prostatakarzinom dar.
Hat Ultraschall ausgedient?
Lange war der Ultraschall die Methode der Wahl zur Steuerung der Stanzbiopsien, mittlerweile hat sich dieses bildgebende Verfahren für die verlässliche Erkennung eines Karzinoms innerhalb der Prostata aber als ungeeignet erwiesen. „Über Jahrzehnte etablierte sich die systematische und ungezielte Biopsie, bei der ein transrektaler Ultraschall lediglich als Orientierungshilfe verwendet wird, als das Standardverfahren zur Gewinnung von Gewebsproben aus der Prostata. Da hier der zufällige Treffer die histologische Diagnose bestimmt, ist es nicht verwunderlich, dass die Detektionsrate von Karzinomen signifikant von der Anzahl der durchgeführten Biopsien abhängig ist. Die Rate an klinisch relevanten Karzinomen, die bei der ersten systemischen Stanzbiopsie dem Nachweis entgehen, liegt bei bis zu 40 Prozent“, sagt Prim. Univ.-Doz. Dr. Martin Uggowitzer, Vorstand des Instituts für Radiologie und Nuklearmedizin am LKH Hochsteiermark.
Dies stellt ein sehr relevantes Problem für den behandelnden Arzt und den betroffenen Patienten dar, weil in Abhängigkeit vom klinisch eingeschätzten Erkrankungsrisiko entweder Laborkontrollen über Monate, ausgedehntere Re-Biopsien gegebenenfalls unter Narkose oder aber eine weiterführende bildgebende Abklärung mittels Magnetresonanztomografie (MRT) die Folge sind.
Gezielte Biopsie
Mit der Etablierung der multiparametrischen MRT der Prostata und der damit möglichen Darstellung von klinisch relevanten Karzinomen war in den letzten Jahren die Entwicklung der bildgestützten und gezielten Biopsie dieser Herde eine logische Folge. Zumal dies bei Verdacht auf eine maligne Erkrankung in nahezu sämtlichen Organsystemen des menschlichen Körpers bereits den diagnostischen Standard darstellt. Die Kombination mehrerer Parameter erhöht die diagnostische Genauigkeit erheblich und liefert damit dem behandelnden Arzt entscheidende Informationen. „Die multiparametrische Magnetresonanztomografie der Prostata bietet neben hohem Weichteilkontrast auch funktionelle Gewebeinformationen und ermöglicht so eine akkurate Diagnostik. Dadurch können Tumoren der Prostata bildgebend visualisiert werden, was eine gezielte Biopsie sowie eine verbesserte Operationsplanung ermöglicht. Durch die Kombination mehrerer Parameter erhöht sich die diagnostische Genauigkeit erheblich“, erklärt Dr. Pascal Baltzer von der Klinischen Abteilung für Allgemeine Radiologie und Kinderradiologie am AKH Wien.
Grundlage für die Eingriffssteuerung bilden morphologische und funktionelle Bilddaten des MRT, die bei einer diagnostischen MRT-Untersuchung der Prostata standardmäßig gewonnen werden. Insbesondere Biomarker, die auch Rückschlüsse auf die Aggressivität des Karzinoms geben, ermöglichen die zielgerichtete Biopsie dieser Areale sowie von Bereichen der Prostata, die mit den bisherigen ungezielten Biopsien nicht erfasst werden, wie etwa die Transitionszone, der Apex, das vordere Prostatadrittel und das anteriore Stroma.
Rasche Diagnose
Bildgestützte und gezielte Prostatabiopsien können einerseits direkt innerhalb des MRT durchgeführt werden, was bei kleinen und exzentrisch lokalisierten Tumoren vorteilhaft ist, andererseits aber auch nach Bildfusion mit geeigneter Software mittels Ultraschall (MR/US-Fusion) ambulant und tagesklinisch. Vorteile sind unter anderem eine Reduktion der Stanzbiopsien zur Diagnosestellung, eine geringere Belastung des Patienten sowie eine raschere Diagnose und Kostenreduktion.
„Die interdisziplinäre Expertise und Kooperation zwischen Radiologie und Urologie und eine qualitätskontrollierte Durchführung bildgestützter Prostatabiopsien in Zentren ist für die Etablierung dieser Methode als zukünftiger Standard nicht nur wünschenswert, sondern unumgänglich“, spricht sich Uggowitzer klar für eine Etablierung der Methode aus.
Transarterielle Embolisation
Klar zu unterscheiden vom Prostatakarzinom ist die sehr häufig auftretende Prostatahyperplasie. Jeder Zweite über 50 Jahre ist damit konfrontiert, bei den über 70-Jährigen sind es bereits 70 Prozent. Die Prostatahyperplasie geht unter anderem mit vermehrtem Harndrang, mit Problemen bei der Blasenentleerung oder mit Schmerzen beim Harnlassen einher. Derzeit gibt es verschiedene konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten: einerseits die Therapie mit Medikamenten, andererseits eine Operation, bei der die vergrößerten Teile der Prostata über die Harnröhre in Narkose mittels Strom oder Laser entfernt werden. Alternativ zur medikamentösen oder operativen Therapie besteht auch die Möglichkeit der Prostata-Arterienembolisation (PAE). Die Embolisation wird unter lokaler Anästhesie durchgeführt, ist schmerzfrei und es ist lediglich eine stationäre Aufnahme für eine Nacht erforderlich.
„Der technische Aufwand ist ähnlich jenem einer Herzkatheter-Untersuchung und daher relativ gering. Allerdings gilt der Eingriff selbst als eine technisch sehr schwierige Intervention, da man in anatomisch sehr komplexe Regionen des menschlichen Körpers gelangt. Unter Röntgendurchleuchtung wird ein dünner Führungskatheter in die Leistenarterie bis zur inneren Beckenarterie eingebracht. Dort wechsle ich auf einen speziellen, sehr dünnen Mikrokatheter und dringe bis zu den Arterien vor, die die Prostata mit Blut versorgen. Durch diesen Mikrokatheter werden kleinste Kunststoffpartikel in die Gefäße eingebracht, der Blutfluss unterbrochen, was eine Schrumpfung der Vorsteherdrüse zur Folge hat. Während des Eingriffs ist der Patient wach und wird bei Bedarf mit Beruhigungs- und Schmerzmitteln versorgt“, beschreibt Dr. Florian Wolf, stellvertretender Leiter der Abteilung für Kardiovaskuläre Bildgebung und Interventionelle Radiologie am AKH Wien, den komplexen Eingriff.
Entscheidend für den Erfolg der Methode ist eine intensive interdisziplinäre Kooperation zwischen dem behandelnden Urologen und dem durchführenden interventionellen Radiologen. Der Urologe stellt die Indikation zur Behandlung und betreut den Patienten urologisch vor und nach dem Eingriff. Der interventionelle Radiologe prüft vor dem Eingriff, ob dieser technisch möglich ist und führt diesen dann durch.