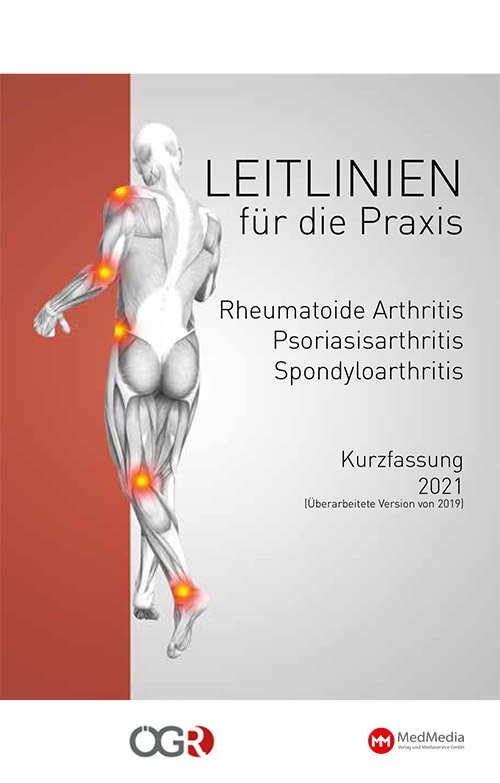Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Allgemeinmedizinern und Rheumatologen verbessert werden?
Die Hot Spots
- Um die rechtzeitige Diagnose zu ermöglichen, wünschen sich die Rheumatologen eine frühzeitige Zuweisung und bieten in 2 unterschiedlich organisierten Pilotprojekten (Akutbegutachtungsambulanz am Wiener AKH und Akutsprechstunde in Oberösterreich) ein extrem niederschwelliges Angebot, das die Patienten zu einer raschen Triage führen soll.
- Um ihren Part in der Betreuung von Rheumapatienten erfüllen zu können, wünschen sich die Allgemeinmediziner von den Rheumatologen vor allem eines: Kommunikation – und das nicht nur einmalig in der Akutabklärung, sondern vor allem in der Führung des chronischen Patienten: denn ein Patient kann nur dann entsprechend geführt werden, wenn sein Hausarzt auch weiß, welche Rheumamedikamente er bekommt, warum er umgestellt wird etc. Hier wird noch viel Verbesserungspotenzial erkannt. Das Defizit dürfte in der Stadt besonders groß sein. Das oberösterreichische Konzept setzt hier auf direktere, auch informelle Kommunikationsmodelle (man greift zum Telefon etc.), die in Wien zum einen schon durch die Strukturen der Großstadt, zum anderen durch die Zentrierung der Rheumatologie auf wenige Spitalsabteilungen (auf 840 Allgemeinmediziner mit Kassenpraxis kommen 4 rheumatologische Ambulanzen) und einen fast nicht existenten niedergelassenen Bereich schwer umsetzbar sein dürften.
Im Focus der Allgemeinmedizin: lebenslange Gesamtbetreuung
„Wir haben ein Riesenproblem“, räumte Professor Redlich bereits in seinem Eingangs-Statement ein, „wir haben kaum niedergelassene Rheumatologen.“ Deshalb sei man in der Rheumatologie extrem auf die gute Zusammenarbeit mit den Fachärzten für Allgemeinmedizin angewiesen.
Doch wo und wann beginnt diese? Die Schwierigkeit in der Interaktion entsteht schon durch den unterschiedlichen Blickwinkel auf den zu betreuenden Patienten. Für die Rheumatologen stehen die Frage „entzündliche oder nicht-entzündliche rheumatische Erkrankung“ und die rechtzeitige adäquate Therapie im Vordergrund. Der Allgemeinmediziner wiederum sieht zum einen nur sehr wenige Patienten mit primär-entzündlichem Rheumatismus, der Großteil leidet an degenerativ bedingten Muskel-/Weichteil-/Gelenkschmerzen.
„Außerdem sind Rheumapatienten ja nicht monomorbid“, wie es Dr. Wilhelm-Mitteräcker pointiert formulierte, „und je älter sie werden, umso multimorbider sind sie.“ Der Focus der Allgemeinmedizin liegt somit in der – im Idealfall lebensbegleitenden – Gesamtbetreuung eines Patienten mit chronischer Erkrankung und einer individuellen Begleitung, um die mit den Erkrankungen und daraus folgenden Therapien verbundenen unterschiedlichen Lebenssituationen zu bewerkstelligen. „Viele Verdachtsdiagnosen kommen von mir, die sich dann bestätigen oder eben nicht. Aber meine Aufgabe sehe ich v. a. darin, Patienten zur Therapieadhärenz zu motivieren, auch wenn sie andere Prioritäten haben. „Das Wichtigste ist im Hier und Jetzt“, betont Wilhelm-Mitteräcker, „bei einem 3-jährigen Kind mit Polyarthritis geht es um andere Gewichtungen als bei einer 80-jährigen Dame mit Früharthritis.“
Um wie viele Patienten geht es eigentlich?
Wie viele Patienten mit primär-entzündlichem Rheumatismus kommen im Durchschnitt auf einen Praktiker? – Egal, welche Inzidenzerhebungen man als Basis nimmt, es sind relativ wenige. Einer von Dr. Puchner zitierten deutschen Untersuchung zufolge sieht ein Allgemeinmediziner alle 2 Jahre eine Erstmanifestation einer rheumatoiden Arthritis (RA). Diese Zahlen decken sich auch mit den persönlichen Erfahrungen: In ihren 29 Jahren als Allgemeinmedizinerin sind bei Wilhelm-Mitteräcker in Summe 15 Patienten mit einer nachgewiesenen entzündlichen rheumatologischen Erkrankung zusammengekommen, von der 3-Jährigen mit Polyarthritis bis zur 25-Jährigen mit Psoriasis-Arthritis (PsA). „Die häufigste entzündliche Erkrankung, die wir als Erstmanifestation sehen, ist die PsA“, so Wilhelm-Mitteräcker: „Wir wissen z. B. seit Jahren, dass ein Patient Psoriasis hat, irgendwann kommt dann eine Gelenkbeteiligung dazu.“
Ähnliches beschreibt auch Dr. Spiegel: Viel häufiger als eine Erstmanifestation einer RA sehe man in der Allgemeinpraxis Patienten mit degenerativen, rheumatischen Beschwerden, bei denen sich dann gelegentlich eine entzündliche Reaktion aufpfropfe. Als Beispiele für Erkrankungen des im weiteren Sinn rheumatischen Formenkreises nennt er neben der sogenannten Pfropf-CP auch häufige Gelenk- und Weichteilerkrankungen, wie z. B. einen „schnellenden“ Finger, Rhizarthrosen, ein Handgelenk-Ganglion, Sehnenscheidenentzündung etc.
Viele dieser Erkrankungen des so genannten erweiterten rheumatischen Formenkreises werden von Spiegel, der sich schwerpunktmäßig mit Erkrankungen des Bewegungsapparates beschäftigt und fachspezifische Weiterbildung in der Rheumatologie und Orthopädie absolviert hat, selbst behandelt, Patienten mit primär-rheumatischen Systemerkrankungen stellt er dem Rheumatologen vor. Die Frage, welche dieser Erkrankungen in der Allgemeinpraxis behandelt bzw. überwiesen werde, kann jedoch nicht generell, sondern immer nur individuell beantwortet werden. Schwerpunkte und Kompetenzen der einzelnen Kollegen sind sehr unterschiedlich, so Spiegel.
Wer führt den rheumatischen Patienten?
Die Frage, ob den Allgemeinmedizinern durch Überweisung Patienten verloren gehen, verneint Wilhelm-Mitteräcker, die – wie erwähnt – im Laufe der Jahre 15 Patienten gesammelt hat: „Diese Patienten haben ja nicht nur eine chronisch-entzündliche Erkrankung, sondern auch andere medizinische Fragestellungen, dazu kommen Lebensveränderungen bis hin zu Verzweiflungsabstürzen, etwa Therapieabbrüche wegen Kinderwunsch etc.“
Redlich betont in diesem Zusammenhang das Angebot der rheumatologischen Abteilungen, bei solch heiklen Fragestellungen zur Verfügung zu stehen. „Wir stellen uns vor, Sie überweisen die Patientin und sie kommt mit einem kurzen klaren Statement zurück, funktioniert das?“ Dieses Prozedere funktioniere schon deshalb, weil Patienten mit einem kurzen Gespräch auf einer Fachabteilung nicht ausreichend versorgt seien, wie Wilhelm-Mitteräcker anmerkt. „Das heißt nicht, dass dieses Gespräch schlecht war, nur manche Dinge muss man öfter und von verschiedenen Seiten beleuchten. Stellen Sie sich vor, jemand erklärt Ihnen in 5 Minuten Ihr Auto und gibt Ihnen einen Dreizeiler, da brauchen Sie schon manchmal eine Erklärung. Der Mensch hat aber keine Betriebsanleitung!“
Hier hakt Spiegel ein: Er ist auf die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Ambulanzen angewiesen – und letztere gibt es zu wenig! Um Patienten überhaupt adäquat versorgen zu können, müssten die Allgemeinmediziner von Fachärzten auch informiert werden, betont Spiegel: „Wenn ich eine Patientin zum Rheumatologen oder in eine rheumatologische Ambulanz schicke, erhoffe ich mir zumeindest eine Kurzmitteilung mit aktualisierter Diagnose und einem begründeten Vorschlag für ein therapeutisches Prozedere.“ Häufig komme aber seitens der Spitalsabteilungen nicht einmal das zurück.
Versorgungs-Modell der Rheumatologen und Hausärzte
Kommunikation ist auch ein Punkt, den der Rheumatologe Puchner für essenziell hält. Er verweist hier auf eine große Umfrage, bei der österreichweit sowohl Rheumatologen als auch Allgemeinmediziner befragt wurden, wie sie sich eine optimale rheumatologische Versorgung vorstellen. Die Mehrheit wünsche sich, dass alles beim Hausarzt beginne und wieder bei diesem ende, dazwischen sei immer wieder der Rheumatologe geschaltet: Die Vorauswahl erfolgt durch den Hausarzt, der den Patienten zur Abklärung zum Rheumatologen schickt, dort folgt die Therapieeinstellung und alle 3–6 Monate eine Kontrolle. Im, wie Puchner betont, von beiden Seiten gewünschten Idealfall erfolge die Weiterverschreibung der Therapie durch den Hausarzt.
Die Frage, wo sinnvollerweise die Vorauswahl erfolgen sollte, wurde kontroversiell diskut
iert. Redlich will hier den Allgemeinmedizinern mehr Unterstützung bieten und propagiert einen möglichst raschen, niederschwelligen Zugang zur Erstuntersuchung beim Rheumatologen. Puchner wiederum betont, dass die große Mehrheit der Befragten eine Vorauswahl beim Hausarzt wünsche.
Niederschwellige Akutbegutachtung soll diagnostische Latenzzeit verkürzen
Seit 2007 gibt es am Wiener AKH eine niederschwellige Akutbegutachtungsambulanz (ABA), die Patienten mit Akutsymptomen ohne Voranmeldung – mit, aber auch ohne Zuweisung – offen steht. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass, obwohl alle um die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose und eines raschen Therapiebeginns Bescheid wissen, immer noch viele Patienten relativ spät zum Facharzt kommen – oft auch, weil dort die Wartezeiten so lang sind, wie Redlich einräumt. „Man hat uns ja seitens der Allgemeinmedizin sehr zu Recht vorgeworfen, dass es den frühesten Termin in 4 Monaten gibt.“ Man habe daher mit der Akutbegutachtungsambulanz (ABA) eine extrem niederschwellige Anlaufstelle geschaffen, wo der Patient akut – d. h. in der Regel am selben Tag, spätestens binnen 3 Tagen – erstbegutachtet, allerdings nicht komplett abgeklärt wird. „Ziel ist eine rasche Triage.“
Ein ähnliches Modell, die so genannte Akutsprechstunde, wurde für den niedergelassenen Bereich auch in Oberösterreich unter der Leitung von Puchner etabliert. Auch dort werden Patienten mit Akutbeschwerden sofort begutachtet und triagiert. Die Akzeptanz sei gut, so Puchner. Er bezeichnet die Akutsprechstunde als Bypass zu einer rheumatologischen Abklärung: Wie in Wien ist es eine Triage-Untersuchung: „Es geht um die Frage entzündlich oder nicht-entzündliche rheumatische Erkrankung.“
Im Zweifelsfall: rasche Zuweisung
Diskutiert wurde in der Folge, welche Kapazitäten in beiden Einrichtungen bestünden. Diese will und kann man jedoch gar nicht begrenzen, sind sich Redlich und Puchner einig. „Die Akutsprechstunde ist für Akutpatienten, hier kann man prinzipiell kein Limit setzen“, betont Puchner. Am Wiener AKH werden in der ABA pro Tag derzeit etwa 15–20 Patienten akutbegutachtet und triagiert. „Und ich wünsche mir, dass es noch viel mehr werden“, wirbt Redlich. Zuweiser sollten hier keine falsche Scham haben, es gehe nicht um „richtige“ oder „falsche“ Diagnosen. Damit wurde letztlich auch ein möglicherweise wunder Punkt in der Kooperation zwischen Allgemeinmedizinern und Fachärzten berührt. Redlich räumt hier (historische?) „Überheblichkeiten“ ein, von denen er sich ganz bewusst distanziere. „Sie als Allgemeinmediziner müssen ohnehin so vieles wissen, und gerade die Rheumatologie ist sehr klinisch orientiert.“ Man könne Diagnosen oft sehr schwer dingfest machen. Im Zweifelsfall, so Redlich, sollte ein und derselbe Patient auch mehrfach vorgestellt werden. Zum einen könne sich die Situation im Laufe von Monaten oder Jahren auch verändern, zum anderen müssten auch Fachärzte, erst recht bei einer nur kurzen Triage-Begutachtung, kritisch hinterfragt werden. „Am meisten habe ich immer vom Patienten gelernt, am zweitmeisten von Kollegen anderer Fachrichtungen“, betont Redlich. Sein Appell: „In dubio pro Zuweisung.“ Und: „Stellen Sie uns Ihre Fragen!“
Doch Letzteres dürfte im Alltag von Großstadt-Kliniken und Spitälern nicht ganz so einfach sein, wie die nachfolgende Diskussion zeigt, die letztlich wieder zum Punkt Kommunikation zurückfand.
Das Angebot der Akutbegutachtung wurde von Wilhelm-Mitteräcker und Spiegel prinzipiell sehr begrüßt. Wilhelm-Mitteräcker: „Wir haben es alle einmal gelernt, aber so eine richtige entzündliche Gelenkentzündung sehen wir selten und können die Diagnosestellung daher auch selten üben.“ Hier seien einerseits Fortbildungsangebote erwünscht, andererseits schätze sie den niederschwelligen Zugang zu spezialisierten Einrichtungen, denn „nicht jeder Patient, der nur ein Heberden’sches Knötchen hat, braucht eine komplette Rheuma-Serologie – von wem auch immer“. Auch Spiegel würde eine niederschwellige rheumatologische Spezialambulanz für sehr hilfreich erachten: Es komme immer wieder vor, dass Patienten sich im medizinischen System verlaufen, weil sie von Ambulanz zu Ambulanz und von Facharzt zu Facharzt ziehen. „Wenn die niederschwellige Zuweisung funktioniert und ich ein konkretes Statement zurückbekomme, wäre das ein Vorteil!“ Diese konkrete Antwort auf die Initialzuweisung gäbe es am AKH zwar standardmäßig: „Sie ist kurz, aber prägnant. Und wenn sie nicht suffizient ist, dann rufen Sie uns an!“ Redlich muss allerdings einräumen, dass es in der Betreuung der chronischen Patienten derzeit de facto sicher viel zu wenig Kommunikation mit dem Hausarzt gibt. „Hier stoßen wir schon seit langem an unsere Kapazitätsgrenzen!“
Langzeitbetreuung:Schwachstelle Kommunikation
Diese Situation in der chronischen Betreuung wird von den Allgemeinmedizinern als äußerst unbefriedigend empfunden. Spiegel betont: „Der Hausarzt kann nur dann etwas unterstützen, wenn er auch die dahinter stehende Rationale kennt!“ Er müsse über die Therapien, Begründungen für Therapiemodifikationen, aktuelle Befunde informiert werden. Spiegel verweist hier beispielsweise auf Medikamente, die einander antagonisieren etc. „Letztlich muss es einen geben, der den Überblick über alle Therapien hat und die Entscheidungen trifft!“ Aber um den Überblick haben zu können, brauche man Information.
Die diskutierten Probleme können hier durchaus als Pars pro Toto für ähnlich gelagerte Kommunikationsdefizite an einer Vielzahl von anderen Ambulanzen gelten. Fehlende Kommunikation ist auch für Puchner als Vertreter des niedergelassenen fachärztlichen Bereiches unverständlich. Ein Arztbrief nach jeder Visite sei für ihn eine absolute Selbstverständlichkeit: „Sonst können wir ja gar nicht zusammenarbeiten! Hausärzte müssen ja über Befunde informiert sein, sie sind ja die Drehschreibe“ – Er legt aber Wert darauf, dass dieses Vorgehen nicht nur „sein“ Modell sei, sondern mittlerweile die Vorstellung der Mehrheit der österreichischen Rheumatologen und Hausärzte, wie durch die überwältigende Zustimmung bei der Umfrage bestätigt werden konnte.
Auch Redlich, der sich der kritischen Diskussion auch stellvertretend für andere kritisierte rheumatologische Abteilungen stellte, versteht die Anliegen. Die „kurzfristige“ Kommunikation bei Erstzuweisung erfolge standardisiert, für die langfristige Kommunikation in der kontinuierlichen Betreuung der Patienten fehlen derzeit die Ressourcen.
Die Kommunikation müsse auch nicht in Briefen erfolgen, verweist Wilhelm-Mitteräcker auf das mittlerweile an onkologischen Abteilungen übliche Prozedere, den Patienten Kopien der Befunde und Ambulanzprotokolle mitzugeben. Dieser Informationsfluss durch die Hand des Patienten sei wichtig. „Zum einen kann auch der Patienten selbst Einsicht nehmen und ich bekomme die Informationen zur Hand!“
Summa summarum bleibt – allen faktischen Widrigkeiten und Strukturdefiziten zum Trotz – der dringende und verständliche Apell der Allgemeinmediziner nach besserer Kommunikation.