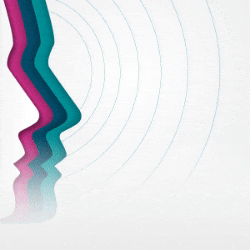Aktuelle Pressearbeit der ÖGN: Kopfschmerz, Migräne und Alzheimer im Fokus
Mehr Aufmerksamkeit für das Thema Alzheimer
„Es gibt zwar noch keine kausale, aber doch symptomatische Therapien gegen Alzheimer und eine Reihe von vorbeugenden Maßnahmen. Darauf möchten wir aufmerksam machen“, sagt Univ.-Prof. Dr. Peter Dal-Bianco, Präsident der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft (ÖAG), anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages am 21. September. Demenzerkrankungen sind die große medizinische und gesellschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Derzeit leiden weltweit rund 50 Millionen Menschen an Demenz, in Österreich etwa 130.000. Die Zahl der Betroffenen (PatientInnen und BetreuerInnen) und die hohen Folgekosten von derzeit mehr als zwei Milliarden Euro pro Jahr in Österreich werden sich aufgrund der steigenden Lebenserwartung bis 2050 mehr als verdoppeln. Die ÖAG und die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) fordern, dem Thema Alzheimer weiterhin die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. „Die Angehörigen von Alzheimer-PatientInnen brauchen bestmögliche Unterstützung. Wir müssen dafür sorgen, dass die bestehenden Hilfsangebote noch praxistauglicher werden und wirklich bei den Betroffenen ankommen“, betont ÖGN-Präsident Univ.-Prof. Dr. Eugen Trinka (Uniklinikum Salzburg).
Noch keine Impfung gegen Alzheimer
„Versuche, durch Impfungen die krankheitsverursachenden A-Beta-Eiweißfädchen im Gehirn zu beseitigen und somit das Fortschreiten der Erkrankung zu stoppen, zeigten bisher leider keinen überzeugenden klinischen Erfolg“, bedauert Trinka. Die schädlichen Eiweiße müssten zudem lange vor dem klinischen Ausbruch der Alzheimer-Erkrankung herausgelöst werden, da diese Veränderungen im Gehirn etwa zwanzig Jahre vor dem Einsetzen der Symptomatik stattfinden. Derzeit wird intensiv an Biomarkern geforscht, um Alzheimer voraussagen und frühzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können.
Obwohl viele neue Therapieansätze untersucht werden, gibt es noch kein Medikament, um den zugrunde liegenden Krankheitsprozess bei Alzheimer zu stoppen. „Wir können nur die Symptome der Krankheit beeinflussen und das Fortschreiten der kognitiven Beeinträchtigung verlangsamen“, erklärt Dal-Bianco. Aktuell stehen zwei Wirkstoffe mit unterschiedlichen Mechanismen zur Verfügung: Zur Cholinesterase-Hemmung dienen die Medikamente Rivastigmin, Donepezil und Galantamin. Sie wirken ähnlich, sind aber individuell unterschiedlich gut verträglich. Die zweite Medikamentengruppe sind die Glutamatrezeptorantagonisten (z. B. Memantin).
Verhaltensstörungen rechtzeitig erkennen und behandeln
Der Großteil der Alzheimer-PatientInnen wird zuhause von Angehörigen oder FreundInnen betreut. „Pflegende Angehörige müssen besser sichtbar gemacht, höher wertgeschätzt und besser unterstützt werden“, fordert Dal-Bianco. In Österreich gibt es zwar gute Netzwerke, Einrichtungen und Programme, aber „man sollte immer wieder daran arbeiten, dass diese Angebote auch in den Alltag der betreuenden Angehörigen einfließen“, so Trinka.
Ein Problem für pflegende Angehörige besteht in der Einstufung der Pflegegeldstufe, da die Schwere der Erkrankung oft falsch eingeschätzt wird. Insbesondere BegutachterInnen, die nicht oft mit Alzheimer-PatientInnen zu tun haben, können sich täuschen lassen. „Die PatientInnen wollen bei der Begutachtung gut dastehen und zeigen eine geistige Leistungsfähigkeit, die sie im Alltag bei weitem nicht haben“, erklärt Dal-Bianco. Die Ärzte/Ärztinnen sollten zudem auch nach Verhaltensauffälligkeiten der PatientInnen fragen: „Reizbarkeit, Ungeduld und Aggression sind Verhaltensänderungen, die von den betreuenden Angehörigen oft verschwiegen werden, weil sie ihre betreute Person nicht bloßstellen wollen. Das Verhalten der Alzheimer-PatientInnen ist im Spätstadium oft das Spiegelbild der Emotionen ihrer BetreuerInnen.“ Verhaltensstörungen sollten rechtzeitig erkannt und behandelt werden.
Für die medizinische Betreuung der immer größeren Zahl von Alzheimer-PatientInnen braucht es in Österreich nicht nur ambitionierte, gut informierte AllgemeinmedizinerInnen, sondern zunehmend mehr neurologische Fachärzte/Fachärztinnen, da Alzheimer mit weiteren neurologischen Erkrankungen verbunden sein kann. In der Spätphase erleiden 5–10 % der Alzheimer-PatientInnen auch einen epileptischen Anfall. In der Endphase der Erkrankung benötigen die PatientInnen häufig neuropalliative Versorgung. „Dazu brauchen wir jetzt und in Zukunft viel mehr niedergelassene Neurologinnen und Neurologen“, so Trinka.
Europäischer Kopfschmerz- und Migränetag: Fokus auf seltenen Kopfschmerzarten
Am 12. September begehen jedes Jahr zahlreiche Organisationen den Europäischen Kopfschmerz- und Migränetag. Auch die Österreichische Kopfschmerzgesellschaft (ÖKSG) und die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) nutzten heuer wieder diesen Anlass, um auf die Bedeutung von akkurater Diagnostik und effektiver Therapie hinzuweisen – und Defizite in der Versorgung zu benennen. 2019 wurden seltene Kopfschmerzformen ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. „Sie bleiben oft viel zu lange unerkannt und werden von der Forschung stiefmütterlich behandelt. Unsere Ziele: mehr Aufklärung und schnellere und bessere Hilfe für Betroffene“, unterstreicht Zebenholzer.
Prim. Univ.-Prof. Mag. Dr. Eugen Trinka, FRCP, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) und Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie an der Christian Doppler Universitätsklinik Salzburg, kritisierte anlässlich des Europäischen Kopfschmerz- und Migränetags die mangelhaften Versorgungsstrukturen: „Einer WHO-Studie zufolge sind Spannungskopfschmerz und Migräne die weltweit zweit- bzw. dritthäufigsten Erkrankungen überhaupt – doch diesem Umstand wird in Österreich zu wenig Rechnung getragen.“1 Er fordert ein abgestuftes und koordiniert funktionierendes Versorgungskonzept, das von Hausärzten/Hausärztinnen als zumeist erste AnsprechpartnerInnen über niedergelassene Neurologinnen/Neurologen bis hin zu einer ausreichenden Zahl spezialisierter Zentren reicht. „Wir brauchen deutlich mehr Spezialeinrichtungen, aber nicht nur das: Die ÖGN versucht auch, innerhalb der Ärzteschaft mehr Bewusstsein zu schaffen, und wir engagieren uns für Aufklärung und Weiterbildung. Noch immer klaffen große Lücken zwischen Experten- und Expertinnen-Empfehlungen und gelebter Praxis. Eine Erhebung in acht österreichischen Kopfschmerzzentren hat gezeigt, dass viele PatientInnen vor der Überweisung in ein spezialisiertes Zentrum keine ausreichende Therapie erhalten haben. Triptane als spezifische Mittel zur Akuttherapie wurden nicht mehr als 6 % der Erwachsenen mit Migräne verordnet“, hob Trinka hervor.2
Clusterkopfschmerzen: winzige Fallzahl, riesige Beschwerden
Wer an einer selteneren Kopfschmerzform leidet, etwa aus der Kategorie der trigeminoautonomen Kopfschmerzen, hat es besonders schwer, rasch an eine richtige Diagnose und adäquate Therapie zu kommen. Der häufigste Vertreter dieser Kopfschmerzart ist der Clusterkopfschmerz. Rund 10 % der ClusterkopfschmerzpatientInnen leiden an einer chronischen, schwer behandelbaren Form, bei der zwischen den Attacken nie länger als drei Monate Schmerzfreiheit besteht. Hier ist Isoptin eine Behandlungsoption. Je nach Einzelfall kann dieser Wirkstoff auch mit Lithium oder Topiramat kombiniert werden, was jedoch häufig mit Nebenwirkungen verbunden ist. Zebenholzer: „Für chronische Clusterkopfschmerzen wäre die Entwicklung neuer Therapieformen sehr wünschenswert. Durch die geringe Zahl an Betroffenen ist die akademische Forschung leider ins Hintertreffen geraten.“ Dasselbe gilt für andere Formen der trigeminoautonomen Kopfschmerzen wie Hemicrania continua, paroxysmale Hemikranie oder das SUNCT-Syndrom (Short-lasting unilateral neuralgiform Headache with conjunctival Injection and Tearing).
„Wie bei allen seltenen Erkrankungen führt kein Weg um internationale Vernetzung
herum, wie sie derzeit auf EU-Ebene mit den Europäischen Referenznetzwerken passiert“, so Trinka. „Mithilfe dieser Plattform können sich Fachzentren und Sachverständige zusammentun und austauschen, um auch bei Kopfschmerzformen mit geringer Fallzahl die bestmögliche Diagnostik und Therapie nach dem neuesten Wissensstand zu finden und gemeinsam die Forschung voranzutreiben.“ Die Europäischen Referenznetzwerke (ERN) sind eine Initiative von Gesundheitsdienstleistern in ganz Europa mit dem Ziel, Wissen über seltene Erkrankungen zu bündeln.
World Brain Day will mehr Verständnis für Migräne fördern
London/Wien/Salzburg, Freitag 19. Juli 2019 – Bereits zum fünften Mal fand am 22. Juli der World Brain Day statt, eine Initiative der World Federation of Neurology (WFN).
In diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der International Headache Society (IHS), der American Academy of Neurology (AAN) und zahlreichen anderen Gesellschaften.
Heuer war der WBD der Migräne gewidmet, der weltweit häufigsten Erkrankung des Gehirns, die die Lebensqualität vieler Menschen empfindlich beeinträchtigt. „Wir arbeiten mit unseren 120 Mitgliedsländern weltweit zusammen, um gegen die Stigmatisierung von MigränepatientInnen anzukämpfen, die Behandlung zu verbessern und mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, welche enormen indirekten Kosten durch Migräne entstehen“, sagt WFN-Generalsekretär Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Grisold (Wien).
Nicht nur für die Betroffenen selbst hat die Krankheit einen hohen Preis. Eine Studie hat ermittelt, dass die jährlichen Kosten für die Migränebehandlung in Europa mit rund 4,1 Mrd. Euro pro Jahr zwar relativ gering sind, die durch die Erkrankung bedingten Arbeitsausfälle jedoch Kosten von 18,4 Mrd. verursachen. Das lässt den Schluss zu, dass ein Großteil der PatientInnen nicht oder nur ungenügend behandelt wird.
Nur 17,5 % der PatientInnen gehen zum Facharzt/zur Fachärztin
„In Österreich ist die medikamentöse Therapie zur Prophylaxe und Behandlung akuter Attacken auf einem hohen Level, und von Migräne Betroffenen könnte sehr gut geholfen werden“, so Trinka. „Allerdings wird hierzulande Migräne zu wenig erkannt, ist unterdiagnostiziert und wird zu selten richtig behandelt.“
Nur 17,5 % der MigränepatientInnen finden den Weg zu einem Facharzt/einer Fachärztin für Neurologie. Um die Versorgung zu verbessern, bedarf es daher auch hier eines abgestuften und koordinierten Zusammenspiels von Hausärzten/Hausärztinnen, niedergelassenen Neurologinnen/Neurologen und spezialisierten Migränezentren.
„Trotz der weltweiten Verbreitung und der hohen volkswirtschaftlichen Kosten von Migräne wird in die Migräneforschung viel zu wenig investiert“, bedauert Prof. Grisold. „Ein gesteigertes Bewusstsein der Allgemeinheit für die Probleme, die Migräne verursacht, hilft der Scientific Community, sich effektiver für die Bedürfnisse der großen Zahl von MigränepatientInnen einzusetzen.“