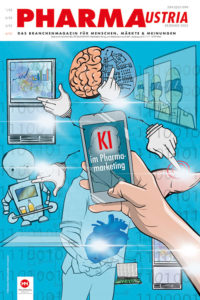Corona-Governance Österreich in Pandemiezeiten
Welche Lehren wir aus der Coronakrise für die Gesundheitsversorgung in Österreich ziehen können, damit beschäftigt sich auch Mag.a Beate Hartinger-Klein, MA. in ihrer Masterarbeit „Corona-Governance Österreich in Pandemiezeiten “ an der Universität Wien. Sie kritisiert darin den Föderalismus der Gesundheitsversorgung in Österreich als Schwäche des Krisenmanagements der Pandemie. Denn die Zersplitterung der Finanzierung und der Verantwortung zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung führe zu Abstimmungsproblemen und Komplexitätsvergrößerung. Dies wirkt sich nach Meinung von Hartinger-Klein nachteilig auf die Gesundheitsversorgung aus. Zudem hätten sich die Bundesländer in der Pandemiezeit für die nötigen Bewältigungsszenarien als zu abhängig von regionalen Lobbys (Beispiel Tourismus) erwiesen. Zwar hätte der Bund durch das Epidemiegesetz weitgehende Durchgriffsrechte gehabt, habe dies aber schlussendlich den Ländern geopfert.
„Eine systemübergreifende Patientensteuerung und besonders eine Verzahnung des extra- und intramuralen Bereichs ermöglicht erst eine resiliente Gesundheitsversorgung für alle, also sowohl für COVID- als auch für Nicht-COVID-Patient:innen“, betont Hartinger-Klein. Weiters kommt sie in ihrer Arbeit zu dem Ergebnis, dass eine bessere Steuerung durch valide Vernetzung von Daten – gerade in Pandemiezeiten – eine Überlastung der Spitäler und damit Krankheit und Tod häufiger hätte verhindern können. „Die Föderalismusfrage im österreichischen Gesundheitswesen muss in Österreich künftig proaktiv angegangen werden. Wenn die Länder die gemeinsam erarbeiteten, operationalisierbaren Vorgaben des Bundes nicht umsetzen, gibt es zwei Lösungen: entweder die Abschaffung des Föderalismus im Gesundheitswesen oder ein Anreiz-/Sanktionsmaßnahmensystem im Rahmen der Zielvereinbarungen“, fordert Hartinger-Klein abschließend.