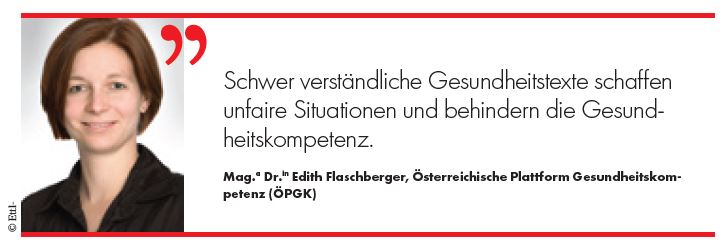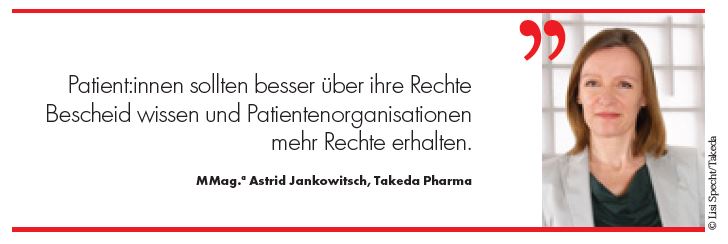Empowerment der Gesundheitskompetenz
Nur durch ein Zusammenspiel unterschiedlicher Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen, die für Health Literacy eine Rolle spielen – Gesundheitsinformation, Gesprächsqualität im Gesundheitswesen, Rahmenbedingungen in Organisationen und Settings sowie Empowerment von Patient:innen und Bürger:innen –, kann die derzeitige Situation positiv verändert werden. Verständlichkeit ist dabei ein wesentlicher Schlüsselfaktor, der sich als roter Faden durch die diversen Teilbereiche zieht.
Anforderungen an Gesundheitsinformationen
„Gesundheitsinformationen sind eine wichtige Grundlage, um Menschen für individuelle Entscheidungen bezüglich ihrer Gesundheit – sei es im Krankheitsfall, zur Gesundheitsförderung oder als Prävention – zu ermächtigen. Daher ist es wichtig, dass qualitativ hochwertige Informationen verfügbar, leicht zugänglich und für die Zielgruppe verständlich sind“, betont Mag.a Dr.in Edith Flaschberger, Health Expert am Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Gesundheitssystem, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), und fachliche Leiterin der Koordinationsstelle der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK).
Sie sieht alle Player des Gesundheitswesens wie auch die Medien in der Verantwortung, solche Informationen zur Verfügung zu stellen und zudem darauf aufmerksam zu machen, dass es sie gibt und wo sie zu finden sind. Dem stimmt MMag.a Astrid Jankowitsch, Head Public Policy, Communications & Patient Advocacy bei Takeda Pharma und Generalsekretärin des FOPI (Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie), zu: „Nur gut informierte Personen können sich um ihre Gesundheit kümmern, denn nur sie wissen, wie sie sich in diesem System bewegen können.“
Dazu nennt sie ein Beispiel: „Gerade bei chronischen oder gar seltenen Erkrankungen ist der Weg bis zur Diagnose für die Patient:innen oft ein sehr langer. Je mehr Wissen die Betroffenen selbst haben bzw. finden können, desto mehr können sie auch selbst zur Diagnosefindung beitragen“, so Jankowitsch.
Auch Dr. Jürgen Soffried, MPH, Senior Consultant im Fachbereich Public Health am Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH (IfGP), Kompetenzzentrum der Sozialversicherung, plädiert für gut aufbereitete und neutrale Informationen, „die niemanden in eine bestimmte Richtung pushen wollen. Denn gut informiert bedeutet nicht automatisch, dass am Ende alle dieselbe Entscheidung treffen.“ Für ihn ist die erste Hürde in Bezug auf Gesundheitskompetenz, wie schwer es jemandem fällt, für ihn relevante Informationen überhaupt zu finden. Sind diese Informationen schließlich gefunden, ist für ihn die Verständlichkeit der entscheidende Faktor.
Zudem sei es wichtig, dass sehr leicht erkennbar ist, von wem die Information stammt – „sprich, wer sie geschrieben hat und wer als Auftraggeber oder Finanzier dahintersteckt. Das heißt, es ist wichtig, dass jede:r leicht überprüfen kann, ob es sich um eine neutrale Information handelt oder nicht“, betont Soffried. Flaschberger sieht dies ähnlich und erklärt, dass man den Bürger:innen Hilfestellungen bieten müsse, wie sie vertrauenswürdige Informationen erkennen.
Patientenzentrierte Kommunikation
Ein weiterer wesentlicher Aspekt in Bezug auf Gesundheitskompetenz ist die Gesprächsqualität. „Ärzt:innen, Apotheker:innen und andere Fachgruppen des Gesundheitswesens müssen patientenzentriert und verständlich kommunizieren. Das erhöht die Patientensicherheit und -zufriedenheit sowie auch die Arbeitszufriedenheit der medizinischen Fachkräfte“, fasst Flaschberger die Vorteile zusammen und weist zudem darauf hin, dass Ärzt:innen neben dem persönlichen Gespräch ihren Patient:innen auch gute schriftliche Informationen mitgeben sollten, „denn viele Patient:innen können sich nicht alle mündlich übermittelten Informationen merken bzw. haben vielleicht nicht alles verstanden. Eine schriftliche Zusammenfassung kann helfen – auch dabei, Fragen für einen weiteren Arztbesuch formulieren zu können.“
Problem organisationale Gesundheitskompetenz
Betrachtet man das hierzulande herrschende Gesundheitskompetenzlevel im Vergleich zu anderen Ländern, liegt Österreich bei der allgemeinen Gesundheitskompetenz mit rund 77 (von möglichen 100) Punkten leicht über dem HLS19‐Durchschnitt (76 Punkte; International Health Literacy Survey). Auch in den einzelnen Bereichen weicht Österreich nur geringfügig vom Durchschnitt ab – mal nach unten, mal nach oben. Jedoch gibt es durchaus Länder, die bessere Ergebnisse als Österreich aufweisen. „Aufgrund der unterschiedlichen Gesundheitssysteme sind direkte Vergleiche der Daten schwierig. Allerdings scheint es, dass die Orientierung im Gesundheitssystem in Österreich mit mehr Hürden verbunden ist als in anderen Ländern“, so Flaschberger.
Im Bereich Navigationskompetenz – damit bezeichnet man die Fähigkeit, sich ohne Probleme und Umwege im Gesundheitssystem zurechtzufinden, um passgenaue gesundheitsförderliche, präventive oder versorgungsbezogene Angebote und Leistungen finden und nutzen zu können – liegt somit ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt, um die Gesundheitskompetenz in Österreich zu erhöhen. Soffried sieht hier ganz klar das System in der Pflicht und betont: „Aus Systemsicht lautet die entscheidende Frage: Wie gut sind unsere Informationen zu finden und wie verständlich sind sie?“ Daher sollte man seiner Meinung nach Nutzertests durchführen, um die Verständlichkeit und Praxistauglichkeit zu überprüfen.
Um die Navigationskompetenz zu erhöhen, muss es also einfacher für die Menschen werden, Informationen zur Orientierung im Gesundheitssystem, zur Prävention und zur Gesundheitsförderung finden, verstehen, einschätzen und anwenden zu können. Dies erfordert (auch) Änderungen auf Systemebene: Das Gesundheitssystem und die Gesundheitseinrichtungen sind aufgerufen, den Menschen mehr Orientierung zu bieten, auch in Bezug auf Angebote und Einrichtungen zur Gesundheitsförderung und Prävention.
Wissen als Basis für „Shared Decision Making“
Empowerment der Patient:innen und Bürger:innen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, um die Gesundheitskompetenz zu erhöhen. Welche Rolle spielen Patientenrechte und das Wissen darüber in Bezug auf dieses Empowerment?
Flaschberger ist der Ansicht, dass eine Stärkung der Patientenrechte bzw. eine verstärkte Bewusstmachung der Patientenrechte bei den Bürger:innen ebenfalls die Gesundheitskompetenz verbessern würde: „Patient:innen haben ein Recht auf Aufklärung. Das müssen sie aber auch wissen!“ Zudem ist es ihrer Meinung nach wichtig, dass die Menschen sich für ihre eigene Gesundheit verantwortlich fühlen, denn: „Es geht um ‚Shared Decision Making‘, bei dem Ärzt:innen und Patient:innen gemeinsam Entscheidungen treffen – Grundvoraussetzung dafür sind informierte Patient:innen!“ Zudem brauche es auch die Kompetenz und die Bereitschaft der medizinischen Fachkräfte, so Flaschberger.
Für Jankowitsch sind die individuellen Patientenrechte in Österreich gut aufgestellt, aber: „Die Patient:innen wissen nicht genug über ihre Rechte und sollten dahingehend mehr aufgeklärt werden. Denn nicht immer werden die Patientenrechte eingehalten – einfordern kann man sie aber nur, wenn man seine Rechte kennt.“ Dies sieht auch Mag.a Katharina Klajnert, Head of Market Access & & Government Affairs bei GSK Österreich, so: „Die Menschen wissen zum einen zu wenig über ihre Rechte als Patient:in Bescheid, zum anderen müssen sie auch in der Lage sein, medizinische Informationen entsprechend zu bewerten, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Mehr Zeit für Aufklärungsgespräche in der ärztlichen Praxis, aber auch in Apotheken, sowie die stärkere Nutzung von digitalen Möglichkeiten können helfen, Potenziale besser zu auszuschöpfen.“
Mehr Rechte für Patientenorganisationen
Jankowitsch wünscht sich zudem mehr Rechte für Patientenvertretungsorganisationen wie z.B. Selbsthilfegruppen. „Patientenorganisationen werden in Österreich immer noch als Laien eingestuft und haben daher keinen Zugang zu manchen Fachinformationen. Eine Stärkung der Rechte von Patientenorganisationen würde bedeuten, dass sie mehr Informationen bekommen – und das wäre für Betroffene sehr positiv!“
Mag.a Sabine Boschetto, Head Country Communications & Patient Engagement bei Novartis Pharma, ist ebenfalls überzeugt, dass eine Aufwertung der Patientenrechte die Gesundheitskompetenz verbessern würde und Patient:innen dadurch selbstbestimmter agieren und Entscheidungen fundierter treffen könnten. Sie plädiert in diesem Zusammenhang so wie Jankowitsch für eine Änderung der Situation bei Patientenorganisationen: „Diese sollten Zugang zu Informationen aus Fachkreisen haben, um ihre wichtige Tätigkeit besser ausüben zu können!“
Und Flaschberger unterstreicht: „Ergänzend sei hier angemerkt: Eine Stärkung der Rolle von Patientenorganisationen erfordert auch eine Stärkung ihrer Qualifizierung – denn mit mehr Kompetenzen ist auch mehr Verantwortung verbunden.“
Bürgerrecht auf Gesundheitsinformation
Soffried hält die in Österreich herrschenden Patientenrechte ebenfalls grundsätzlich für ausreichend, fordert aber dennoch: „Es sollte ein Bürgerrecht auf gute und neutrale Gesundheitsinformation geben! Das heißt, die öffentliche Verwaltung, der Bund, die Länder, die Sozialversicherung etc. müssen den Menschen gute, umfassende, leicht verständliche und neutrale Informationen zur Verfügung stellen. Vielleicht müsste man hierfür sogar eine eigene Stelle neu etablieren. Das wäre meiner Ansicht nach eine wichtige Ergänzung der bestehenden Patientenrechte.“ In diesem Zusammenhang wünscht sich Soffried, dass die Bürger:innen mehr Forderungen an das System stellen, um neutral und leichter verständlich über Gesundheitsthemen informiert zu werden.