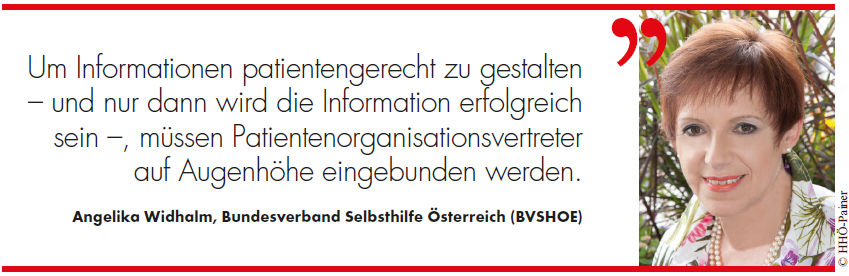Empowerment von Patienten
Wunsch und Bedürfnis nach Gesundheitsinformationen sind bei vielen Menschen vorhanden. Aber wie sollte verständliche Patienteninformation am besten gestaltet sein? Wer sollte der Aussender dieser Informationen sein? Welche Rolle kann, darf und sollte die Pharmaindustrie dabei spielen? PHARMAustria hat Dr. Gerald Bachinger, Patientenanwalt für Niederösterreich, Priv.-Doz. Dr. Claudia Wild, Geschäftsführerin des Austrian Institute for Health Technology Assessment, Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner und Medical Creative Director beim MedMedia Verlag, sowie Angelika Widhalm, Vorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe Österreich, dazu befragt.
Eigenverantwortung braucht Gesundheitskompetenz
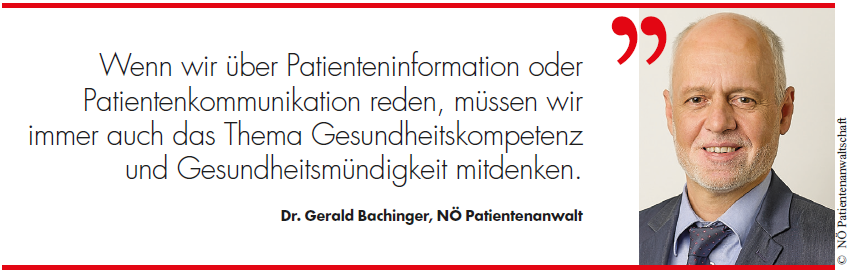 Für NÖ Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger sind Patienten Co-Produzenten ihrer Gesundheit: „Es geht bei Gesundheitsinformation letztendlich um das Partizipieren an der eigenen Gesundheit. Um Entscheidungen treffen zu können, braucht man evidenzbasierte, ausgewogene und begreifbare Information.“ Doch selbst wenn diese Information vorhanden ist, erklärt Bachinger, sehe man nicht zuletzt am Beispiel COVID-19, dass es auch ein Gegenüber braucht, das diese Information entsprechend aufnehmen und verarbeiten kann: „Voraussetzung für gute Information ist Gesundheitsmündigkeit oder Gesundheitskompetenz oder auf Englisch: Health Literacy.“ Bachinger verweist in diesem Zusammenhang auf die niedrige Gesundheitskompetenz in Österreich (siehe Kasten). In seinen Augen sind das Gesundheitswesen und die gesamte Zivilgesellschaft aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheitskompetenz zu erhöhen.
Für NÖ Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger sind Patienten Co-Produzenten ihrer Gesundheit: „Es geht bei Gesundheitsinformation letztendlich um das Partizipieren an der eigenen Gesundheit. Um Entscheidungen treffen zu können, braucht man evidenzbasierte, ausgewogene und begreifbare Information.“ Doch selbst wenn diese Information vorhanden ist, erklärt Bachinger, sehe man nicht zuletzt am Beispiel COVID-19, dass es auch ein Gegenüber braucht, das diese Information entsprechend aufnehmen und verarbeiten kann: „Voraussetzung für gute Information ist Gesundheitsmündigkeit oder Gesundheitskompetenz oder auf Englisch: Health Literacy.“ Bachinger verweist in diesem Zusammenhang auf die niedrige Gesundheitskompetenz in Österreich (siehe Kasten). In seinen Augen sind das Gesundheitswesen und die gesamte Zivilgesellschaft aufgerufen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheitskompetenz zu erhöhen.
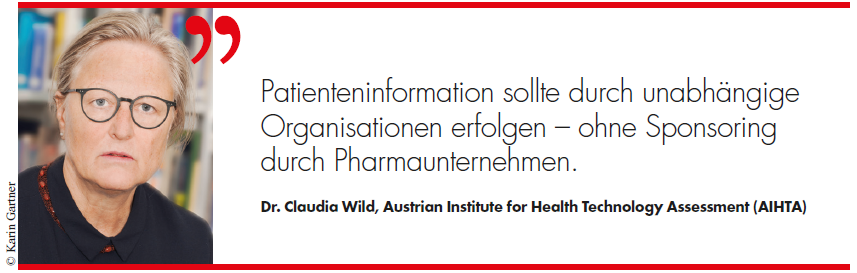 Auch für Priv.-Doz. Dr. Claudia Wild, Geschäftsführerin des Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA), das sich als unabhängige Instanz der wissenschaftlichen Entscheidungsunterstützung im Gesundheitswesen definiert, heißt das Schlüsselwort, damit Menschen ihrer Eigenverantwortung bei Gesundheitsentscheidungen nachkommen können, Gesundheitskompetenz: „Es braucht Health Literacy, damit Menschen mit ihrer Krankheit selbst umgehen können. Der Betroffene muss wissen, ob es bei seiner Erkrankung Ursachen gibt, bei denen zum Beispiel mehr Bewegung, bessere Ernährung oder bessere Psychohygiene sinnvoll wäre. Und wenn eine medikamentöse Therapie erforderlich ist, sollten die Betroffenen die verschiedenen Optionen kennen und nicht glauben, dass nur eine spezielle Therapie die einzige Möglichkeit ist.“
Auch für Priv.-Doz. Dr. Claudia Wild, Geschäftsführerin des Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA), das sich als unabhängige Instanz der wissenschaftlichen Entscheidungsunterstützung im Gesundheitswesen definiert, heißt das Schlüsselwort, damit Menschen ihrer Eigenverantwortung bei Gesundheitsentscheidungen nachkommen können, Gesundheitskompetenz: „Es braucht Health Literacy, damit Menschen mit ihrer Krankheit selbst umgehen können. Der Betroffene muss wissen, ob es bei seiner Erkrankung Ursachen gibt, bei denen zum Beispiel mehr Bewegung, bessere Ernährung oder bessere Psychohygiene sinnvoll wäre. Und wenn eine medikamentöse Therapie erforderlich ist, sollten die Betroffenen die verschiedenen Optionen kennen und nicht glauben, dass nur eine spezielle Therapie die einzige Möglichkeit ist.“
Evidenzbasiert und ausgewogen
Ausgewogenheit, also die umfassende Darstellung eines Themas, ist auch für Bachinger ein wichtiger Aspekt: „Einzelne Punkte zum Beispiel aus einer Studie herauszugreifen, weil diese zu meiner Argumentation passen, und andere wegzulassen, die nicht passen, ist weder ausgewogen noch evidenzbasiert.“ Für medizinische Laien sei es aber oftmals schwer bzw. gar nicht nachvollziehbar, ob nun alle wesentlichen Fakten berücksichtigt wurden und der Kontext ausreichend dargestellt wird oder nicht. „Hier kommt man auch mit einer guten Gesundheitskompetenz nur bis zu einem gewissen Level. Darüber hinaus braucht man dann Unterstützung von Fachleuten, um alles einordnen zu können“, so Bachinger.
Gut vorbereitet ins Arztgespräch
… oder: „Die ‚Gott in Weiß‘-Zeit ist vorbei“, bringt es Angelika Widhalm, Vorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe Österreich (BVSHOE), dem Dachverband der bundesweit tätigen themenbezogenen Selbsthilfe- und Patientenorganisationen Österreichs, auf den Punkt. Denn heute sitzen in den Arztpraxen häufig gut informierte Patienten. Und natürlich auch welche mit dem berühmt-berüchtigten gefährlichen Halbwissen. Aber unabhängig davon, wie gut vorinformiert der jeweilige Patient ist: „Arzt-Patienten-Kommunikation muss auf Augenhöhe stattfinden, denn das ist eine wichtige Voraussetzung für eine von Arzt und Patient gemeinsam auf Augenhöhe getroffene Therapieentscheidung und eine gute/hohe Compliance bei der Therapiedurchführung. Dafür brauchen Patienten Informationen und Kenntnis ihrer Patientenrechte“, betont Widhalm. Denn schließlich werde zwischen Arzt und Patient ein Behandlungsvertrag abgeschlossen, der auch die Therapieverschreibung enthält – das alles müsse für den Patienten individuell verständlich sein. „Aber oftmals hat der Arzt keine Zeit für die notwendigen Erklärungen – daher suchen die Patienten anderswo nach Informationen. Diese gilt es daher zur Verfügung zu stellen“, sagt Widhalm, die ebenfalls der Meinung ist, dass die Erhöhung der Gesundheitskompetenz oberstes Gebot im Gesundheitswesen ist.
Auch Dr. Christian Maté kann aus seiner beruflichen Laufbahn heraus die Bedeutung von Patient Empowerment nur unterstreichen: „Ich bin nicht nur als Allgemeinmediziner tätig, sondern beschäftige mich seit Langem – bereits seit meiner Zeit als Leiter der Plattform netdoktor und auch jetzt als Medical Creative Director beim MedMedia Verlag – mit dem Thema Gesundheitskompetenz. Was sich bei netdoktor von den hohen Zugriffszahlen ableiten lässt, sehe ich als Arzt Tag für Tag im Kontakt mit den Patienten: Wenn es um die eigene Gesundheit geht, haben die meisten Menschen ein natürliches Informationsbedürfnis.“ Die Kunst bestehe nun darin, dieses Bedürfnis zu nutzen, um den Bedarf zu decken: „Im Windschatten dessen, was mein Patient wissen möchte, kann ich ihn mit Informationen versorgen, von denen ich glaube, dass er sie kennen sollte, um wieder gesund zu werden“, so der Mediziner. Die Grundlage dafür sei ein von Vertrauen und Empathie getragenes Gespräch, das natürlich nicht zwischen Tür und Angel stattfinden könne. „Wenn es der Gesellschaft ernst ist mit der Erhöhung der Gesundheitskompetenz, muss für das Arztgespräch ein entsprechender zeitlicher Rahmen etabliert werden“, betont Maté.
Wie macht man sich verständlich?
Gefragt nach den wichtigsten Kriterien für medial vermittelte Gesundheitsinformation verweist Maté auf das Hamburger Verständlichkeitsmodell. Dieses nennt vier Kriterien für die Verständlichkeit von Texten: Einfachheit, Gliederung/Ordnung, Kürze/Prägnanz sowie zusätzliche Stimulanz, d.h. das Geschriebene spricht Gefühle an, z.B. durch anschauliche Beispiele. „Es geht um eine allgemein verständliche Sprache, keine Schachtelsätze, wenig Fachausdrücke und: nicht zu viele Infos auf einmal, denn unserer Aufnahme- und Merkfähigkeit sind nun mal Grenzen gesetzt“, erläutert Maté.
Widhalm betont, dass jeder Patient die Information verstehen müsse, daher sei es wichtig, die sehr komplexen Themen herunterzubrechen: „Patientenvertreter können aufgrund ihrer Praxiserfahrung und Expertise aufgrund spezieller Schulungen viel zur Verständlichkeit beitragen.“ In ihren Augen sind die wichtigen Aspekte, um die Rezipienten zu erreichen, folgende: Verständlichkeit, ausreichende valide Information, Neutralität, unterschiedliche Sichtweisen und Transparenz, damit die Informationen eingeordnet werden können – „… und am besten mehrsprachig! Wobei Übersetzungen immer auch die Kultur beachten müssen“, unterstreicht Widhalm.
Begreifbar ist mehr als nur verständlich
Für Bachinger ist Verständlichkeit bei Patienteninformationen ebenfalls wichtig, er geht aber noch einen Schritt weiter und knüpft damit an den letzten Punkt des Hamburger Verständlichkeitsmodells an, die zusätzliche Stimulanz: „Meiner Meinung nach muss Information begreifbar sein – das geht über Verständlichkeit hinaus! Begreifbar heißt für mich eben nicht nur per Ratio verständlich, sondern auch emotional erlebbar. Das erreiche ich nur, wenn ich zielgruppengerecht kommuniziere. Bevor man Informationen aussendet, muss man sich daher mit den verschiedenen Zielgruppen, bei denen diese Information ankommen soll, beschäftigen.“ Es gebe eben kein Patentrezept für die Bevölkerung, denn „die Bevölkerung gibt es nicht, sondern es gibt verschiedenste Gruppen, die ganz unterschiedliche Hintergründe, wie z.B. soziale Einbettungen, haben. Das alles muss man bei guter Information mitberücksichtigen. Man muss die jeweilige Zielgruppe wirklich dort abholen, wo sie derzeit ist“, so Bachinger.
Weiters sollte seiner Ansicht nach „begreifbare Information“ neben Texten auch mit Bildern, Animationen, Filmen und Grafiken arbeiten. „So lässt sich zum einen die wichtige emotionale Komponente berücksichtigen. Damit kann man die Menschen erreichen und ins Boot holen. Zum anderen können Fakten in Grafiken und Bildern oftmals begreifbarer dargestellt werden. Gerade mit Grafiken lässt sich beispielsweise die Risikobewertung sehr gut und verständlich abbilden. Diese ist oftmals ein wichtiger Punkt bei Patienteninformationen und für Laien häufig schwer einzuordnen“, erklärt der Patientenanwalt.
Informationswiderstände niederreißen
Auch für Zielgruppen, die in der Kommunikation besonders herausfordernd sind, hat Bachinger einen Tipp parat: „Gerade bei solchen Zielgruppen, von denen ich weiß, dass sie schwierig zu erreichen sind, kann es hilfreich sein, wenn jemand aus dieser bestimmten Peergroup, also ‚einer von ihnen‘, für die Kommunikation eingesetzt wird. So kann es gelingen, Informationswiderstände niederzureißen.“
Transparenz als wichtige Voraussetzung
Bei der Frage, wer Patienteninformationen herausgeben sollte, vertreten die Befragten sehr unterschiedliche Positionen. So betont Wild ganz klar, dies dürfe eigentlich nur von unabhängigen Stellen erfolgen – auch wenn die Praxis in Österreich anders aussehe. Für Bachinger, Widhalm und Maté sind jedoch auch Patienteninformationen von unabhängigen Stellen, z.B. Patientenorganisationen, gemeinsam mit Pharmaunternehmen möglich – wenn dabei bestimmte Aspekte erfüllt werden. „Die wichtigste Voraussetzung bei einer Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen ist immer die vollkommene Transparenz“, unterstreicht Bachinger. Es dürfe nie so sein, dass beispielsweise eine Patientenorganisation vorgeschickt werde und im Hintergrund ein potenter Partner – sprich, eine Pharmafirma – steht, über den der Rezipient nicht informiert wird, erklärt er. „Wenn aber eindeutig offengelegt wird, welcher Sponsor dabei ist, und die Information unabhängig erstellt wurde, sehe ich überhaupt kein Problem, Patienteninformationen gemeinsam mit der Pharmaindustrie herauszugeben“, so Bachinger weiter.
Reine Information von Pharmaunternehmen sieht der Patientenanwalt hingegen ein wenig skeptisch, denn: „Die eigenen Kinder sind ja immer die schönsten. Und natürlich hat sich ein Pharmaunternehmen für das eigene Produkt sehr engagiert und viel Geld hineingesteckt. Das führt dazu, dass man bei der Kommunikation über bzw. rund um das Produkt schon ein wenig mit Scheuklappen agiert. Daher ist es hilfreich, hier eine Außensicht einzuholen, um das im Gesamtorchester der verschiedensten Aktivitäten einbetten zu können. Man ist somit gut beraten, wenn man unbeteiligte, informierte und kompetente Dritte hinzuzieht“, legt Bachinger den Pharmaunternehmen ans Herz. Er betont in diesem Zusammenhang aber auch, selbst viele Informationen gesehen zu haben, die von einem Pharmaunternehmen ohne Zusammenarbeit mit Dritten herausgebracht wurden und sehr gut gelungen waren. „Aber es wirkt natürlich objektiver und ausgewogener, wenn mindestens ein zweiter Partner beteiligt ist“, sagt Bachinger.
Bevormundung von Patienten
Maté nimmt eine ähnliche Position ein wie der Patientenanwalt: „Einerseits wissen Pharmaunternehmen am meisten über ihr Produkt, andererseits verbinden sie damit eben legitimerweise ein kaufmännisches Interesse. Daher halte ich es für den besten Weg, wenn Pharmafirmen Patienteninformationen gemeinsam mit Partnern, z.B. Ärzten, Patientenorganisationen etc., herausbringen. Gerade wenn Ärzte beteiligt sind, ist in meinen Augen eine Kontrollfunktion gegeben, denn diese können die Informationen der Pharmaunternehmen reflektieren und entsprechend gefiltert an die Patienten weitergeben.“
Auch die Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen und Verlagen hält er bei Patienteninformationen für sinnvoll: „Bei Fachverlagen fließt das Know-how der Redakteure ein, zudem können wissenschaftliche Vertreter hinzugezogen werden“, weiß Maté aus der Praxis. Er kann den Ruf, Patienteninformation von Pharmaunternehmen zu untersagen, zwar zu einem gewissen Teil nachvollziehen, „aber das wäre letztendlich eine Bevormundung der Patienten, da man bestimmte Informationen von ihnen fernhalten würde. Daher halte ich das derzeitige Modell, in dem es klare rechtliche (z.B. Stichwort Laienwerbeverbot) und auch ethische Richtlinien (z.B. Stichwort PHARMIG-Verhaltenskodex) gibt, für den besseren Weg.“
Wann wird Information zu Lobbyismus?
Wilds Position zu Patienteninformationen von Pharmaunternehmen ist, wie bereits erwähnt, deutlich restriktiver. Ihrer Meinung nach sollten Patienteninformationen nur von unabhängigen öffentlichen Institutionen veröffentlicht werden, z.B. von Patientenanwaltschaften, HTA-Institutionen etc. „Völlig inakzeptabel finde ich, dass Patienteninformationen von der Industrie selbst produziert werden. Aber in einer demokratisch organisierten Welt ist es nun mal so, dass die Interessengruppen ihre Interessen auch an den Mann bzw. die Frau bringen dürfen“, bedauert Wild. Ihrer Ansicht nach betreiben Pharmaunternehmen jedoch Patientenlobbyismus, statt ausgewogen zu informieren. Und sie unterstreicht: „Meiner Meinung nach sollten Pharmafirmen gar nicht mit Patienten kommunizieren, sondern die Fachärzte. Sie sind diejenigen, die die Krankheit und die Patienten am besten kennen. Ärzte sollten natürlich ebenfalls unabhängige Informationen erhalten, um über alle Behandlungsoptionen objektiv informieren zu können. Dasselbe gilt auch für Patientenverbände. Es gibt eine hochgradige Evidenz dafür, dass nur jene Patientenverbände von Pharmaunternehmen gesponsert werden, die sich mit Erkrankungen beschäftigen, für die es teure Medikamente gibt. Und wer Geld erhält, ist beeinflusst. Daher sage ich ganz klar: Wenn Patientenverbände von Pharmaunternehmen finanzielle Zuwendungen erhalten, ist die Information nicht mehr unabhängig.“
Widhalm sieht dies hingegen als Vertreterin der Patientenorganisationen anders: „Es müssen klare Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen Patientenorganisationen und Pharmaunternehmen, insbesondere hinsichtlich Transparenz, vereinbart, schriftlich/vertraglich festgehalten und entsprechend nach außen kommuniziert werden. Im Rahmen dieser Vorgangsweise ist eine Zusammenarbeit in meinen Augen zulässig – und auch sinnvoll!“
Patientenorganisationen einbinden
Widhalm betont weiters, dass eine Patientenorganisation aufgrund ihrer Organisationsstruktur einen großen Wissenspool darstelle, der Betroffene und deren Angehörige sowie Fachbeiräte (medizinisch, arbeits- und sozialrechtlich, ethisch u.v.m.) beinhalte. „Ihre Vertreter haben viel Wissen und Kompetenz über die Thematik und können darüber hinaus auch aus Erfahrung sprechen. Im gesamten Gesundheits- und Sozialsystem muss daher kollektive Pa
tientenbeteiligung – durch die Einbeziehung von Patientenorganisationen – umgesetzt werden“, so ihre Forderung.
Sie plädiert daher klar dafür, dass Pharmaunternehmen Patientenorganisationen einbinden sollten – und zwar nicht erst bei der Information über Therapieoptionen: „Die Einbindung von Patientenorganisationsvertretern bereits in der Studienkonzeptionsphase hebt nachweislich die Qualität des Studiendesigns und des Ergebnisses.“ Ihr ist wichtig, dass bereits die Themen gemeinsam festgelegt werden und Patientenvertreter zudem in die Erstellung der Information eingebunden werden, denn: „Die Patientenvertreter wissen als Erfahrungsexperten, welche Aspekte für die Betroffenen essenziell wichtig sind, aber oftmals zu wenig berücksichtigt werden. Dazu gehören Informationen aus der eigenen Erfahrung über das Leben mit der Diagnose/der Erkrankung, über die Symptome, die Therapie, Folgeerkrankungen und deren Behandlungen, psychologische und soziale Themen etc. Zudem sollte der Weg durch das Gesundheitssystem kurz zusammengefasst werden. Hier kommen wiederum die Fachbeiräte ins Spiel, die in die Patientenorganisationen eingebunden sind.“ Widhalm verweist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich auf die dringend notwendige Transparenz.
Patienteninformationen, die Pharmaunternehmen alleine erstellen, erteilt auch sie eine Abfuhr, wenn auch aus anderen Gründen als Wild: „Die Informationen, die Pharmaunternehmen ohne Unterstützung bzw. Kontrolle von außen erstellen, erfüllen oftmals nicht die angesprochenen Qualitätskriterien. Laut meiner – nicht repräsentativen – Einschätzung sind nur 5% der Patientenbroschüren von Pharmafirmen wirklich gut. Es gibt also deutlich Luft nach oben. Und die Lösung dieses Qualitätsproblems ist das Einbeziehen der Patientenorganisationen – nicht nur an dieser Stelle.“
Awareness-Kampagnen: Keine zu hohen Hoffnungen wecken!
Bezüglich Awareness-Kampagnen, die von Pharmaunternehmen gemeinsam mit Patientenorganisationen durchgeführt werden, hat Bachinger gemischte Gefühle: „Auf der einen Seite halte ich es für eine sehr gute Initiative, wenn man Betroffene als Experten über die eigene Erkrankung mit ins Boot nimmt. Auf der anderen Seite habe ich bereits einige negative Awareness-Kampagnen erlebt, weil dabei Erwartungen von Betroffenen geweckt wurden, die der Evidenz nicht entsprochen haben.“ Hier zieht er ganz klar eine rote Linie: „Patientenhoffnungen dürfen nicht für Geschäftszwecke ausgenutzt werden! Dadurch gewinnt letztendlich niemand“, warnt der Patientenanwalt. Für ihn ist es daher ein No-Go, wenn einzelne Patienten, die sich aufgrund ihrer Erkrankung in einer ganz schlimmen Leidenssituation befinden, vorgeschickt werden, um medial Informationen zu verbreiten, die viel mit Hoffnung, aber wenig mit Evidenz zu tun haben. „Ein solches Vorgehen dient dazu, das Gesundheitssystem insgesamt in eine erpresste Situation zu bringen, und das ist für mich kein gutes Signal“, kritisiert Bachinger. Für ihn gilt es bei Awareness-Kampagnen von Pharmaunternehmen und Patientenorganisationen eine entsprechende Balance zu finden: „Einerseits muss die Kompetenz der Patienten in die Kampagne hereingeholt werden, andererseits dürfen die Patienten nicht vorgeschickt werden, um für ein bestimmtes Präparat Stimmung zu machen. Diesen beiden Aspekten gerecht zu werden ist eine Herausforderung, der sich alle Beteiligten stellen müssen.“
Ziel und Zweck definieren
Maté schließt sich der Haltung von Bachinger an: „Man darf bei Awareness-Kampagnen keine Hysterie und keinen Druck erzeugen. Daher muss man gerade bei Awareness-Kampagnen das Ziel und die Umsetzung besonders kritisch hinterfragen. Eines sollte man sich dabei immer vor Augen halten: Awareness dient dem Patientenwohl! Das muss das Ziel sein – auch wenn es durch die Kampagne wirtschaftlich gesprochen zu einer Marktausweitung kommt.“ Bei allen Arten von Patienteninitiativen sollten sich Pharmafirmen daher immer fragen, warum sie diese machen wollen, und den ethischen Grund ermitteln. Maté: „Umsatzsteigerung kann und darf nicht das Ziel sein, das würde auch gar nicht funktionieren. Es geht vielmehr um Sinnstiftung: Patient Relations ist Teil der Gesamtverantwortung der Pharmaunternehmen! Ich bin daher – frei nach dem Autor und Unternehmensberater Simon Sinek – der Meinung, dass sich Pharmafirmen im Zusammenhang mit Patienteninitiativen zunächst die Frage nach dem ‚Warum‘ stellen sollten. Erst danach sollten sie sich mit dem ,Was‘ und dem ,Wie‘ beschäftigen.“
Auch Bachinger betont, dass der Zweck klar definiert werden müsse, und rät Pharmaunternehmen, sich vorab folgende Frage zu stellen: „Ist diese Broschüre vom Zweck her dafür gedacht, dass ich den Informationsstand der Patienten verbessere? Dann sage ich ja dazu, das ist eine gute Patienteninformation. Oder ist diese Broschüre dazu da, Patienten vorauszuschicken, um Stimmung zu machen, damit das Gesundheitswesen in irgendeiner Form reagiert? Dazu sage ich nein, das ist eine schlechte Patienteninformation!“
Die Idealkomposition für gute Information
Für Bachinger würde das ideale Szenario einer guten Patienteninformation folgendermaßen aussehen: „Zunächst einmal wäre es ein guter Weg, wenn sich Pharmafirmen entweder als PHARMIG oder als FOPI an einer Patienteninformationsbroschüre, einer Awareness-Kampagne etc. beteiligen. Wenn dies nicht möglich oder sinnvoll ist, könnten sich zum Beispiel zu bestimmten Indikationen mehrere Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, zusammenschließen und gemeinsam Patienteninformationen herausgeben. Und zwar nicht alleine, also nicht nur Pharma unter sich, sondern gemeinsam mit Betroffenen bzw. Selbsthilfegruppen und Fachexperten. Das wäre wahrscheinlich die Idealkomposition für gute Information“, so Bachinger.
Widhalm sieht dies ähnlich. Auch in ihren Augen wäre der Idealfall einer Broschüre (oder eines anderen Mediums) folgender: von einer Patientenorganisation herausgegeben, gemeinsam mit verschiedenen Experten/Partnern wie z.B. Fachärzten verfasst und mit Pharmaunternehmen als Sponsoren veröffentlicht. Sie appelliert an Pharmaunternehmen, Patienten und ihre Vertreter nicht vereinnahmen zu wollen, sondern mit ihnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Widhalm abschließend: „Wenn auf diese Art valide und ausgewogene Information erstellt, zudem auf höchste Transparenz geachtet und diese entsprechend kommuniziert wird, kann der Rezipient die Broschüre/das Medium inklusive der enthaltenen Informationen entsprechend gewichten und einordnen. Dementsprechend steigt die Glaubwürdigkeit der Patienteninformation. Das wäre eine Win-win-Situation, die aber nur gelingt, wenn gegenseitiger Austausch stattfindet. Dieser hebt ja auch die Kompetenz bei allen Beteiligten, weil wir voneinander lernen können. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige, valide Informationen, die dann Menschen wirklich helfen können.“
Gesundheitskompetenz in Österreich
„Studien belegen, dass Österreich bezüglich Health Literacy zu den Schlusslichtern im EU-Ranking gehört. Wir sind darin in etwa auf einer Ebene mit Bulgarien, weit abgeschlagen von Ländern wie Finnland, Schweden und Dänemark. Das ist einer der Gründe, warum wir beispielsweise jetzt in der Corona-Situation mit evidenzbasierter Information nicht weiterkommen. Information ist ein Geben, aber auch ein Nehmen. Wenn es beim Gegenüber an Gesundheitsmündigkeit fehlt, kann die Information noch so gut aufbereitet sein, sie wird nicht ankommen“, erläutert NÖ Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger.
Grundvertrauen in Wissenschaft aufbauen
Qualitätskriterien für Patienteninformation
Die Österreichische Plattform Gesundheitskompetenz (OEPGK) hat 15 Qualitätskriterien, eingeteilt in 3 Kategorien, für zielgruppenorientierte, evidenzbasierte Broschüren, Videos, Websites und Apps zusammengefasst:
Grundlagen:
Auswahl und Darstellung der Fakten:
Glaubwürdigkeit:
Vertiefende Informationen unter: