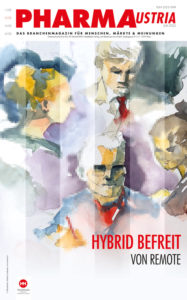Gesundheitsdaten und die Zukunft der Medizin
Die Digitalisierung stellt einen wesentlichen Faktor bei der Forschung und Entwicklung neuer Therapie- und Diagnoseansätze dar und wird benötigt, um Patient:innen besser behandeln zu können. Ohne Gesundheitsdaten kann eine Präzisionsmedizin, wie sie unter anderem in der Krebsdiagnostik eine bedeutsame Rolle spielt, nicht funktionieren. Dabei ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von enormer Bedeutung. In einem Expert:innengespräch wurden im Rahmen des 125-jährigen Roche-Firmenjubiläums die Hürden der Digitalisierung in der Medizin identifiziert und das umfangreiche Potenzial von routinemäßig erhobenen Gesundheitsdaten beleuchtet.
Digitale Hürden und das Potenzial der Gesundheitsdaten
Im Zeitalter der Digitalisierung ist es von hoher Wichtigkeit, veraltete Normen und Hürden aufzubrechen und innovativen Lösungsansätzen Raum zu geben. Augenöffnend für die digitalen Hürden war für Dr. Uta-Maria Ohndorf, General Manager Roche Diagnostics GmbH, eine persönliche Situation vor 15 Jahren, als sie als Angehörige den kräfteraubenden Prozess einer Tumordiagnose miterlebte. Die Tumorpatientin wurde dabei innerhalb von drei Tagen zu verschiedensten Untersuchungen geschickt und erhielt nach jeder Untersuchung einen Stapel an Befunden, die am Ende dem behandelnden Onkologen zu überreichen waren. Weder waren die darin enthaltenen Informationen für die Patientin in einer lesbaren und interpretierbaren Form, noch war der Prozess der Informationsweitergabe zeitgemäß.
Diese prägende Situation illustrierte bereits damals zwei große Defizite in der Digitalisierung, die noch heute präsent sind: unzureichender Fokus auf die Patient:innen und eine unausgereifte digitale Vernetzung in der Diagnostik. Dabei werde täglich eine Vielzahl an anonymisierten Gesundheits- und Patientendaten erhoben und in diesen Daten stecke das Potenzial, weitere Erkenntnisse zur Entstehung und Behandlung von Krankheiten zu gewinnen, erklärte Susanne Erkens-Reck, MSc, General Manager Roche Austria GmbH. Würden die innovativen Präventions-, Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten klarer auf die Patient:innen zugeschnitten, ließe sich nicht nur das Management, sondern auch das Gesundheitssystem selbst weiter optimieren. Die zentrale Frage lautet hierbei: Wie lassen sich diese anonymisierten Gesundheitsdaten zum Wohle der Patient:innen verantwortungsvoll nutzen?
Vernetzung der Gesundheitsdaten
Unzureichende Verknüpfung
Eine wesentliche Einschränkung sieht Angelika Widhalm, Vorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe Österreich (BVSHOE), in der unzureichenden Verknüpfung der Patientendaten. Wechselt man beispielsweise im Zuge der Diagnostik oder des Behandlungsprozesses das Krankenhaus, findet man sich oft in der Situation, bereits durchgeführte Untersuchungen wiederholen zu müssen. Dies führt zu einem Zeitverlust und einem – vermeidbaren – zusätzlichen Aufwand. Eine bessere Vernetzung könnte hingegen zu einer rascheren Diagnose und einer optimierten, validen Therapie führen.
Das sieht auch ao. Univ.-Prof. Dr. Peter Klimek, Faculty Member Complexity Science Hub, MedUni Wien, so. Die dafür benötigten Daten und Technologien wären durch das Sozialversicherungssystem zu einem großen Teil bereits verfügbar. Ein wesentlicher Schritt zur Optimierung des Gesundheitssystems wären beispielsweise Analysen, wo in Österreich die beste Patientenbehandlung erfolgt. Dadurch könnte man betroffenen Patient:innen die bestmögliche Therapie anbieten und es würde ein nachhaltiges System geschaffen.
Potenzial verantwortungsbewusst nutzen
Neben Informationen zur Diagnose und Therapie enthalten Gesundheitsdaten aber auch ein prognostisches Potenzial. Einen neuen Begriff stellt hier die sogenannte „Precision Public Health“ dar und ermöglicht dem Gesundheitssystem durch die Vernetzung der Daten, Informationen über den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung zu gewinnen, erklärte Klimek weiter. Derzeit gibt es viel Forschung in Richtung sogenannter Krankheitstrajektorien, bei denen es um die Identifikation kritischer Ereignisse von Krankheiten geht. Wenn man versteht, wie es einem Patienten mit Typ-2-Diabetes im Alter von 50 Jahren geht, kann man vielleicht jemanden mit Prädiabetes im Alter von 40 Jahren rechtzeitig identifizieren und ihm eine Vorsorgeuntersuchung nahelegen.
Dem prognostischen Potenzial der Gesundheitsdaten stimmte auch Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer Gesundheit Österreich GmbH, zu. Die Muster, die sich aus den vernetzten Daten erkennen lassen, könnten so auch zur Diagnose von seltenen Erkrankungen herangezogen werden. Voraussetzung ist eine eindeutige Identifikationsnummer. Hieraus ergeben sich aber auch Hürden, denn in einer kleinen Patientenpopulation mit speziellen Merkmalen können Patient:innen sehr rasch diesen Identifikationsnummern zugeordnet werden, was die Anonymisierung erschwert. Hierfür bedarf es qualitativer und vernünftiger regulierter Forschung.
Vergleichbarkeit gewährleisten
Während nur 2% der Gesundheitsdaten aus klinischen Studien stammen, werden 98% in der täglichen Behandlungsroutine gewonnen, führte Erkens-Reck weiter aus. Diese Daten werden im Gegensatz zu klinischen Studiendaten aber nicht in einem stark kontrollierten, standardisierten Setting erhoben und eine Vernetzung wird somit erschwert. Hier bedarf es Lösungen hinsichtlich der Automatisierung und Standardisierung der Daten.
Verbesserte Einbindung der Patient:innen
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die derzeit noch unzureichende Einbindung der Patient:innen. Es muss den Betroffenen ermöglicht werden, ihre Gesundheitsdaten selbst zu erfassen und letztendlich – nach einer strukturierten Aufbereitung – auch zu verstehen, erläuterte Prof. Dr. Tanja Stamm, PhD, Head of Section for Outcomes Research, MedUni Wien. Patient:innen könnten beispielsweise am Smartphone den Verlauf ihrer Erkrankung verfolgen und mit Endpunkten aus Studien vergleichen und dabei zeitgleich jegliche Begriffe und Definitionen abrufen. Die Daten sollten also nicht nur der Forschung dienen, sondern auch den individuellen Patient:innen zugutekommen.
Das vorhandene Interesse der Patient:innen an diesen Gesundheitsdaten hat sich insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie gezeigt. Dieses Interesse müsse nun gefördert werden, führte Widhalm weiter aus. Der Therapieerfolg einer Behandlung ist stets höher, wenn die Patient:innen an die Behandlung glauben. Um der Therapie allerdings zu vertrauen, ist ein umfangreiches Verständnis notwendig. Für den Therapieerfolg und auch für die Adhärenz ist daher eine Einbindung der Patient:innen von großer Bedeutung.
Konkrete Schritte
Um die erkannten Hürden zu überwinden und das Potenzial der Gesundheitsdaten zu nutzen, empfiehlt Ohndorf, ein Pilotprojekt unter Einbeziehung der Bevölkerung zu planen und durchzuführen. Dabei sollte eine Skalierbarkeit bereits im Konzept verankert sein, damit das Projekt auch über Wachstumsmöglichkeiten verfügt. Ein zentraler Aspekt muss hier die Regulierung sein, und hierfür müssen alle Stakeholder – Patient:innen, Vertreter:innen der Industrie, Gesundheitspersonal, Wissenschafter:innen und Politiker:innen – zusammenarbeiten.