Pharma als „Patient Advocacy“?
Für diesen Artikel wurden die Patient-Relations-Verantwortlichen von sechs Pharmaunternehmen – AbbVie, Janssen, Novartis, Pfizer, Roche und Takeda – interviewt. Sie alle betonen, dass Patientenkommunikation in ihren Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Den Grund dafür bringt Mag. Judith Kunczier, External Affairs Director, AbbVie Österreich, auf den Punkt: „Die Betroffenen selbst müssen im Mittelpunkt stehen, wenn es darum geht, Entscheidungen im Gesundheitsbereich zu treffen. Dafür ist es notwendig zu verstehen, welche Bedürfnisse, Wünsche und Ziele Menschen mit Erkrankungen haben. Nur mit diesem Wissen kann ihre Lebensqualität und somit auch ihre Gesundheit verbessert werden.“
Patienten verstärkt im Fokus
Dr. Sylvia Nanz, Medical Director bei Pfizer Austria und dort auch für das Thema Patient Relations zuständig, betont, dass Patientenkommunikation/-information innerhalb der Pharmafirmen in den letzten zehn Jahren verstärkt in den Fokus gerückt sei; vorher habe man sich mehr auf die Ärzte als Zielgruppe konzentriert. „Wir entwickeln Therapien und müssen die Patientensicht miteinbeziehen, um den Therapieerfolg zu gewährleisten“, ist auch sie überzeugt. „Zudem haben Patienten heute durch das Internet mehr Möglichkeiten – und auch den Wunsch –, sich sowohl über Erkrankungen als auch zum Thema Gesundheit bzw. Gesundheitsförderung zu informieren. Dieses Informationsbedürfnis wollen wir erfüllen. Denn je mehr ein Patient über seine Erkrankung weiß und auch die Ziele einer Therapie versteht, desto höher ist die Adhärenz“, erklärt Nanz.
Mag. Bernadette Keusch, Patient Advocacy Manager bei Takeda Österreich, meint ebenfalls, dass der Stellenwert der Patientenkommunikation gestiegen sei: „Dies gilt nicht nur für Pharmaunternehmen, in denen es heute eigene Abteilungen für diesen Bereich, wie z.B. Patient Relations, Patient Advocacy etc., gibt, sondern generell auf gesundheitspolitischer Ebene. Hier sind Patienten als Stakeholder-Gruppe ebenfalls deutlich wichtiger geworden. Es ist uns daher auch ein Anliegen, Patientenorganisationen auf ihrem Weg zu mehr Mitbestimmung im Gesundheitssystem zu unterstützen.“
Reger Austausch zwischen Entwicklern und Nutzern
Der Wunsch der Patientenvertreterin Angelika Widhalm, Patienten bereits in die Planung von Studien miteinzubeziehen (siehe Seite 19), rennt in den befragten Unternehmen offene Türen ein. So betont beispielsweise Kathrin Otto, Patient Engagement Lead bei Novartis Austria: „Wir haben bei Novartis die Vision, als Pioniere das erste Pharmaunternehmen zu sein, das die Patientensicht vom Anfang bis zum Ende unserer Arbeit miteinbezieht. Neue Wege zu finden, um das Leben von Patienten sowie ihrer Angehörigen zu verbessern und zu verlängern, ist das Ziel, für das wir Tag für Tag arbeiten. Nur gemeinsam können wir bessere Lösungen für Patienten finden und die medizinische Praxis nachhaltig verändern.“
Auch Mag. Christoph Slupetzky, Patient Engagement and Advocacy Lead, Janssen Austria, betont: „Der Austausch zwischen Entwicklern und Betroffenen – und zwar je früher, desto besser – wird in unserer Industrie immer wichtiger. Früher war dieser Aspekt ein ,nice to have‘, heute ist es ein ,must have‘.“ Dem stimmt auch Keusch zu: „Wir müssen die Bedürfnisse der Patienten verstehen, um die bestmögliche Unterstützung anbieten zu können. Genau um diesen Aspekt geht es auch bei dem H2O-Projekt.“ (siehe Kasten)
Mag. Stephanie Schremmer und Mag. Katharina Winkler-Adametz, beide Patient Community Partner bei Roche Austria, sehen dies genauso. Schremmer fügt hinzu, dass die Erfahrung, Expertise und Perspektive der Patienten auch bei der Entwicklung von Tools, die über Arzneimittel und Diagnostika hinausgehen (wie Webseiten, Apps oder digitale Plattformen etc.), essenziell seien. Deshalb sei es wichtig, Themen mit Patientenorganisationen und Patienten zu diskutieren. Winkler-Adametz betont: „In den letzten Jahren ist es hinsichtlich dieser Zusammenarbeit zu einem Paradigmenwechsel gekommen: von einem eher statischen Modell, bei dem wir Patientenorganisationen bei eigenen Projekten lediglich unterstützt haben, hin zu partnerschaftlichen Beziehungen auf Augenhöhe, bei der die nachhaltige Kollaboration im Vordergrund steht.“
Empowerment durch Information
Auch aufseiten der Pharmaunternehmen ist man sich bewusst, dass es gilt, die Health Literacy – die Gesundheitskompetenz – in Österreich zu stärken. Dazu wollen die Firmen auch gerne ihren Beitrag leisten. „Aufklärung in Form von Information hilft beispielsweise, mit Mythen und Tabus aufzuräumen und Verständnis für Betroffene zu schaffen. Zudem ist Information über ein Krankheitsbild wichtig für die Früherkennung einer Erkrankung und die Wahl der adäquaten Therapie zur Behandlung“, erläutert Kunczier. Und Winkler-Adametz ergänzt: „Im gesundheitlichen Kontext wird der Begriff des ‚mündigen Patienten‘ immer wichtiger. Das bedeutet: mehr Eigenverantwortung, höherer Stellenwert von Erfahrungswissen, Mitgestaltung gesundheitspolitischer Entscheidungen, Abbau von Stigmatisierungen etc.“
Otto unterstreicht in diesem Zusammenhang auch die ethische Bedeutung von Patienteninformation: „Mündige Patienten brauchen Informationen, um Entscheidungen treffen und sich Gehör verschaffen zu können. Es geht um Aufklärung, um Empowerment der Betroffenen, indem diese zum Beispiel ihre Möglichkeiten kennen. Pharmaunternehmen sind dabei ebenso wie alle anderen Partner im Gesundheitssystem (z.B. Arzt, Patientenorganisationen, Pflegepersonal etc.) eine wichtige Informationsquelle für Patienten.“
Pharma als Teil des Dialogs
Dass die Patienteninformation durch Pharmafirmen in der Außensicht teilweise kritisch bewertet wird, ist den Befragten bewusst. Sie betonen jedoch, dass es in den Unternehmen ein großes Bewusstsein für die ethische Verantwortung gebe – und auch entsprechende Regelwerke, die das Vorgehen nicht nur rechtlich, sondern auch ethisch reglementieren. Weiters nennen sie vielfältige Gründe, warum sie es für sinnvoll halten, als Pharmaunternehmen Patienteninformationen herauszugeben bzw. Partner dabei zu unterstützen. „Durch unsere intensive Forschungsarbeit konnte sich AbbVie großes medizinisches Wissen über Erkrankungen, Behandlungen und den Gesundheitsbereich aneignen. Dieses Wissen möchten wir weitergeben – unter dem Gesichtspunkt der fairen, ausgewogenen und patientengerechten Informationsaufbereitung“, berichtet beispielsweise Kunczier aus der Praxis. Ähnlich sieht dies Nanz: „Betroffene und auch deren Angehörige brauchen vertrauenswürdige Informationen. Wissenschaftliche Artikel wie z.B. Studienberichte sind aber – selbst, wenn sie in deutscher Sprache verfügbar sind – für medizinische Laien schwer verständlich. Daher ist es erforderlich, dass patiententaugliche Informationen zur Verfügung gestellt werden. Dies sollte auch von Pharmaunternehmen erfolgen – nämlich zu jenen Themen, bei denen die Firmen das entsprechende wissenschaftliche Know-how aufweisen.“
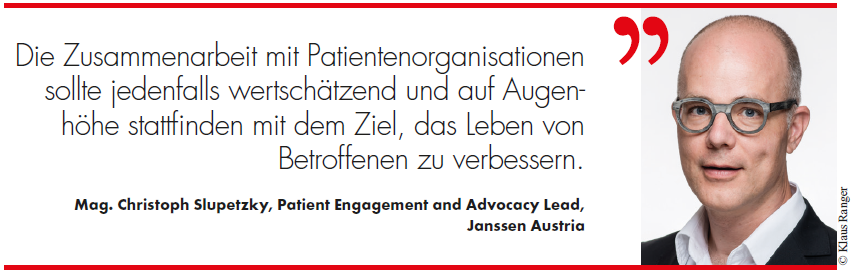
Auch Otto betont: „Die Aufgabe von Patient Engagement ist es, die Schnittstelle zwischen der forschenden Industrie, den Patienten und den Angehörigen zu sein. Es geht darum, Anlaufstelle zu sein, die Anliegen zu hören, zu verstehen und im Sinne von ,no decision about me without me‘ auf Augenhöhe gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten, die die Perspektive der Patienten respektiert und versteht.“
Slupetzky hält es generell für unverzichtbar, dass bei Patienteninformationen alle Stakeholder eingebunden sein müssen; dazu gehören Experten, Vertreter von Betroffenen und auch die pharmazeutischen Unternehmen – „sonst funktioniert die Information nicht“, ist er überzeugt. Es gehe auch darum, den Dialog zwischen Ärzten, Pflege und Betroffenen zu fördern, da Patienten und ihr Umfeld zunehmend autonom reagieren und immer besser informiert werden wollen.
Partner werden einbezogen
Auch die Mitarbeiter der Pharmaunternehmen sind selbstverständlich der Meinung, dass Patienteninformation ausgewogen, neutral und medizinisch fundiert sein muss. Der rechtliche Rahmen werde dabei vom österreichischen Arzneimittelgesetz und dem PHARMIG-Verhaltenskodex klar geregelt, so der allgemeine Tenor. Dazu kommen noch die bereits erwähnten internen Richtlinien der jeweiligen Unternehmen. Die Verständlichkeit steht bei der Erstellung von Patienteninformation auch für die Pharmaunternehmen klar im Fokus. Damit diese gewährleistet ist, holen sich die Unternehmen oftmals Unterstützung. „AbbVie setzt beispielsweise bei der Erstellung von Patienteninformation auf Partnerschaften mit Ärzten, Patientenvertretern und anderen Experten wie Psychologen, Physiotherapeuten oder Ernährungsberatern“, so Kunczier.
Otto erklärt, wie wichtig für Novartis gerade die Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen ist: „Wir versuchen genau hinzuhören, wo aktuell Unterstützung gebraucht wird, an welchen Themen die Patientenorganisationen zum Beispiel gerade arbeiten, die wir gemeinsam voranbringen könnten.“ Die Unabhängigkeit und die Integrität der Patienten und der Patientenorganisationen würden dabei immer gewahrt, so Otto.
Keine versteckte Werbung!
Den Vorwurf, dass bei Patienteninformation Umsatzsteigerung im Fokus stehe, weisen die Befragten zurück. Man sei sich bewusst, dass auch versteckte Werbung die Reputation der Pharmabranche schädigen und so das Vertrauen der Patienten und der anderen Stakeholder erschüttern würde. Daher: „Oberstes Gebot ist die Gewährleistung einer produktunabhängigen und objektiv gestalteten Kommunikation“, betont Winkler-Adametz. Und Slupetzky unterstreicht: „Patientenkommunikation von Pharmaunternehmen soll aufklären, unterstützen, Zuversicht geben. Es muss eine klare Trennung zwischen Werbung und Awareness geben. Die Inhalte müssen sich auf den Bedarf der Betroffenen fokussieren und sind im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und dem Verhaltenskodex der Industrie zu verfassen. Wir haben hier eine große Verantwortung, denn einzelne Negativbeispiele können unsere ganze Branche in Misskredit bringen und viele konstruktive Bemühungen erschweren oder sogar zunichtemachen.“
Langfristig denken
„Pharmaunternehmen konzentrieren sich bei der Patientenkommunikation selbstverständlich auf Themen bzw. Therapiebereiche, in denen sie auch wirtschaftlich unterwegs sind, denn das sind die Bereiche, in denen die jeweilige Firma wissenschaftliche Expertise aufweist“, erklärt Nanz. Um den Vorwurf, dass bei der Patientenkommunikation wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stünden, zu entkräften, ist ihrer Meinung nach Folgendes zu beachten: „Ganz entscheidend ist es, die Kommunikation mit Patienten und auch die Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen immer langfristig zu denken!“
Auch für Keusch ist Langfristigkeit einer der wichtigsten Faktoren: „Wenn Pharmaunternehmen Patientenvertreter unterstützen, muss das Ziel immer sein, die Patientenorganisation nachhaltig stärken zu wollen, und zwar auf Basis der Wünsche und Bedürfnisse der Patienten.“
Hohes Maß an Transparenz
Nanz betont weiters: „Auch Transparenz ist von großer Bedeutung. Unterstützungen müssen auf der Firmenwebsite offengelegt werden und es dürfen nie Bedingungen daran geknüpft sein.“ Auch Otto hält die Offenlegung von finanziellen und nichtfinanziellen Beiträgen für sehr wichtig, „damit klar ist, wie die Zusammenarbeit genau abläuft“.
Für Nanz ist es auch durchaus möglich und wünschenswert, dass mehrere Pharmaunternehmen gemeinsam ein Projekt einer Selbsthilfegruppe o.Ä. unterstützen oder daran mitarbeiten – wie z.B. von Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger als „Idealvariante“ skizziert (siehe Seite 20). „Natürlich ist das sinnvoll und sollte gemacht werden. Teilweise findet es auch bereits statt“, so Nanz. Dies sieht Keusch genauso: „Es gibt Patientenorganisationen, die mehrere Pharmaunternehmen gemeinsam ins Boot geholt haben – und das kann durchaus als ,best practice‘ bezeichnet werden. Ein gutes Beispiel sind gemeinsame Plattformen, die von der Patientenorganisation gehostet und von mehreren Pharmaunternehmen fachlich und finanziell unterstützt werden.“
Weniger ist mehr
Was ist nun bei der Gestaltung der Patienteninformation zu beachten? Nanz gibt zu bedenken, dass bei Patienteninformation immer die Balance zwischen „alle Informationen zur Verfügung stellen“ und „die Patienten nicht überfordern“ zu finden sei: „Weniger ist oftmals mehr, aber es muss dennoch ausreichend und ausgewogen informiert werden. Für vertiefende Informationen kann man Links anbieten. Die verlinkten Seiten müssen natürlich entsprechende Qualitätsanforderungen erfüllen.“
Otto ergänzt: „Verständlichkeit braucht eine laiengerechte Sprache. Das ist sicher eine Herausforderung: Komplexe Informationen detailliert genug – damit die Vollständigkeit gegeben ist – und dennoch verständlich zu vermitteln.“ Keusch sieht dies genauso: „Es geht um übersichtliche Informationen, die auf das Wesentliche reduziert sind, ohne dabei nur an der Oberfläche zu kratzen. Dabei sollte immer im Vordergrund stehen, dass die Informationen für die Betroffenen nützlich sind. Daher ist es wichtig, die Patienten zu fragen, was sie brauchen.“
Neben der verständlichen Sprache sind für Nanz auch bei der optischen Gestaltung einige wesentliche Dinge zu beachten: „Auch die Schriftgröße und die Schriftfarbe tragen zur Verständlichkeit bei, denn die Texte sollen gut lesbar sein! Zudem sind leicht verständliche Abbildungen wichtig, sofern sie den geschriebenen Inhalt ergänzen und sich gut einprägen lassen.“
Erfolgreiche Patienteninformation
Für Slupetzky ist ein wichtiger Punkt für den Erfolg einer Patienteninformation die Einbindung von Betroffenen im Sinne einer nutzerzentrierten Entwicklung. Zudem empfiehlt er, bei der inhaltlichen und optischen Gestaltung auf folgende Aspekte zu achten: „Erstens: Bei manchen Patientenbroschüren fühlt man sich schon als Gesunder krank – das ist der falsche Weg. Es geht darum, Hoffnung zu geben und Möglichkeiten aufzuzeigen, mit der Erkrankung umzugehen. Hier ist es wichtig, die Menschen inhaltlich und emotional abzuholen. Zweitens: Man braucht Zugang zu Informationen, die gut aufbereitet und seriös sind und den letzten Stand des Wissens abbilden. All das fördert Eigenverantwortung und Eigenkompetenz.“ Was viele Mitarbeiter von Unternehmen seiner Ansicht nach immer noch oft übersehen: „Ein Großteil der Patienten hat keinen Universitätsabschluss und oft auch keine Matura, viele haben sprachliche Barrieren. Der Inhalt muss so gestaltet sein, dass er relevant und verständlich für möglichst viele Menschen ist.“

Schremmer weist auf die Wichtigkeit der zielgruppenspezifischen Ausrichtung und Gestaltung von Patienteninformation hin: „Informationen sollten immer so aufbereitet werden, wie sie für die jeweilige Zielgruppe am nützlichsten sind. Zuerst müssen die Bedürfnisse der entsprechenden Zielgruppe genau geklärt werden. Welchen Informationsbedarf gibt es? Informieren sich Betroffene eher auf Websites oder über soziale Medien oder mittels gedruckter Publikationen? In welcher Form muss der Inhalt für das betreffende Medium aufbereitet werden? Auf Basis dieser Bewertung erfolgt der weitere Aufbau unter Einbeziehung von Experten und Verwendung fundierter Quellen.“
Awareness: Informieren, nicht überfordern!
In Bezug auf Awareness-Kampagnen betont Slupetzky: „Wir wollen informieren und nicht überfordern. Awareness-Kampagnen sollten mit und für Betroffene gestaltet werden. Ausgangspunkt muss sein: Welche Informationsbedürfnisse gibt es? Das geht oft nicht ohne die Einbindung von Kommunikationsexperten sowie der Rechts- und Compliance-Abteilungen.“
Für Kunczier zeichnen sich Awareness-Kampagnen, die etwas Positives bewirken, dadurch aus, dass sie die Betroffenen erreichen und bewegen: „Gelungene Awareness-Kampagnen gehen auf die Situation der Betroffenen ein, sprechen deren Wünsche, Ziele und Bedürfniss
e an und bieten gesicherte Information und Lösungen. Um das zu garantieren, muss sowohl die Stimme als auch die Situation der Patienten gut eingebracht werden. Dafür ist die Partnerschaft mit Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen, Ärzten und Experten enorm wichtig.“ Auch Influencer spielen in ihren Augen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Communitys in den sozialen Medien zu erreichen, denn „immer mehr Patienten nutzen digitale soziale Kanäle, um sich über ihre Erkrankung zu informieren und mit anderen Betroffenen auszutauschen“, so Kunczier.
Auch Keusch hält es für wichtig, das Thema attraktiv und emotional aufzubereiten, damit die Menschen sich angesprochen fühlen. „Zudem können Awareness-Kampagnen besser gelingen, wenn sie einen Anreiz bieten, dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken – denn niemand setzt sich gerne mit Krankheiten auseinander. Und gute Beispiele zeigen: Eine solche Kampagne darf auch einmal zum Schmunzeln anregen – damit werden schwere Themen oft leichter.“
Gemeinsam mehr erreichen!
Nanz ist der Ansicht, dass Awareness-Kampagnen idealerweise immer mit Partnern wie z.B. Fachgesellschaften, Patientenorganisationen, Ärzten und/oder Apothekern umgesetzt werden sollten: „Je mehr Partner, desto besser. Auch mehrere Firmen können als Sponsoren beteiligt sein.“
Schremmer betont: „Klar ist, Initiativen für Betroffene gestalten wir gemeinsam mit Betroffenen. Bei Awareness-Kampagnen empfiehlt es sich, immer den individuellen Fall zu betrachten – die Zielgruppe, die Hintergründe und Bedürfnisse der jeweiligen Partner und ob man zu einer sinnvollen Einigung über ein Projekt gelangt.“ Und Otto empfiehlt: „Die Botschaft der Kampagne sollte stets im Vordergrund stehen. Zudem sollte man Awareness-Kampagnen immer von Betroffenen rezensieren lassen, denn umfangreiches Feedback ist auf jeden Fall sehr wichtig. Dabei sollten u.a. folgende Fragen abgedeckt werden: Ist das Thema für Patienten relevant? Sind die Abbildungen passend gewählt? Ist das eine Sprache, die den Patienten gerecht wird? – Und das gilt nicht nur für Awareness-Kampagnen, sondern für jede Art von Patientenkommunikation!“
Slupetzky betont ebenfalls die hohe Bedeutung von Partnerschaften bei Awareness-Kampagnen – er geht sogar noch einen Schritt weiter: „Früher waren Verlage und Patientenorganisationen Partner von Kampagnen, die von Firmen geleitet wurden. Heute sind vermehrt Firmen Partner von Awareness-Kampagnen, die von Patientenorganisationen in Zusammenarbeit mit Verlagen und Agenturen entwickelt werden.“ Das ist in seinen Augen ein Paradigmenwechsel, der für alle Beteiligten Sinn macht, denn unmittelbar Betroffene können völlig anders begreifbar machen, was es bedeutet, Patient zu sein. „Persönlich kann ich sagen: Die Zusammenarbeit mit Menschen, die es neben dem Meistern von oft furchtbaren Schicksalen auch noch schaffen, anderen Menschen zu helfen, ist jeden Tag aufs Neue sinnstiftend und inspirierend“, so Slupetzky abschließend.
Das H2O-Projekt: Health Outcomes Observatories
Zielgruppenbeteiligung bei der Erstellung von Gesundheitsinformation
- Die Zielgruppe gewinnt höheres Vertrauen in die Gesundheitsinformation, kann diese besser verstehen und im Alltag anwenden.
- Die Ersteller stellen die Qualität der Gesundheitsinformation sicher.
- Die Multiplikatoren verfügen über eine Gesundheitsinformation, die den Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht.
- Die Geldgeber setzen ihre Mittel optimal ein, da sich durch die Zielgruppenbeteiligung die Effektivität der Gesundheitsinformation erhöht.






















































































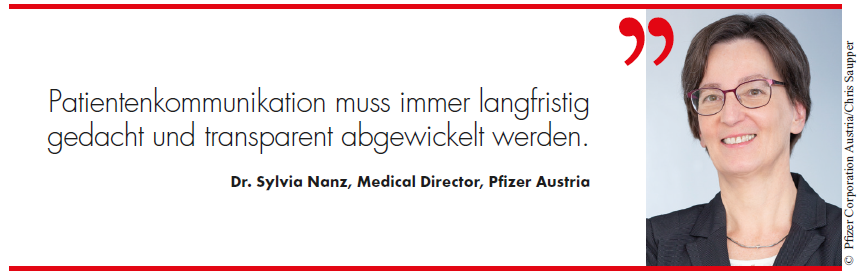
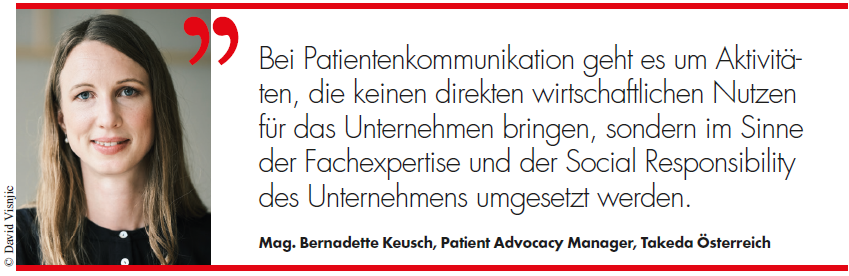

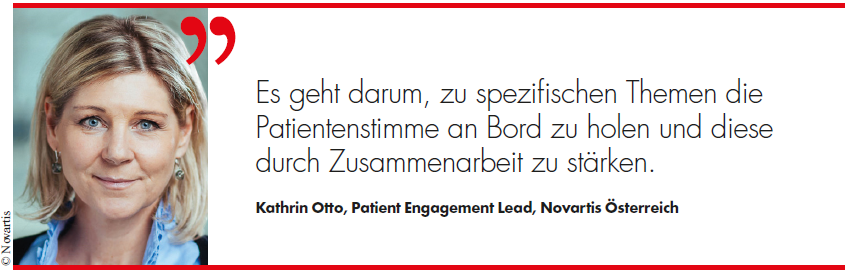

 Kommentar von Mag. Andrea Maierhofer, Leitung Business Unit Ärzte Krone, MedMedia Verlag
Kommentar von Mag. Andrea Maierhofer, Leitung Business Unit Ärzte Krone, MedMedia Verlag_Oliver_Miller-Aichholz_opt.png)