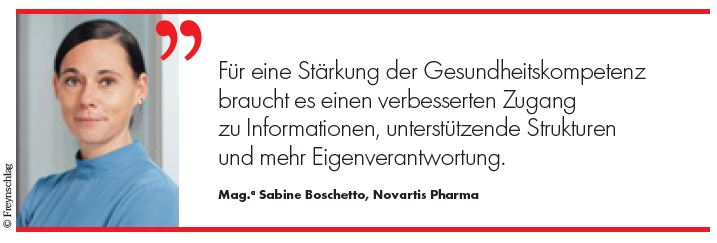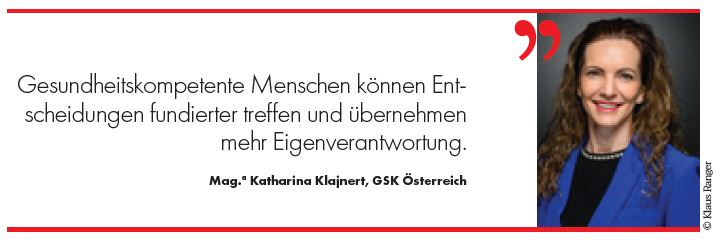Verstärkter Fokus auf Prävention
Mag.a Sabine Boschetto, Head Country Communications & Patient Engagement bei Novartis Pharma, sieht einen erheblichen Einfluss von Gesundheitskompetenz auf die Gesundheitsförderung und Prävention. „Dass in Österreich Nachholbedarf in Sachen Gesundheitskompetenz besteht, wirkt sich nicht nur im Bereich Therapie negativ aus, indem z.B. Behandlungsmöglichkeiten nicht oder nur mangelhaft verstanden werden, sondern auch in Bezug auf Präventiv- und Lebensstilmaßnahmen“, ist sie überzeugt. Sie hält eine umfassende Information für die wesentliche Strategie, um die Gesundheitskompetenz zu erhöhen: „Wir sehen es bei Novartis als unsere Aufgabe, Patient:innen ausführlich und transparent mit Informationen zu versorgen. Dies gilt auch im Bereich Prävention, indem wir z.B. Bewusstsein schaffen, Vorsorgemaßnahmen wahrzunehmen. Dabei stellen wir uns immer die Frage, welche Informationen Patient:innen brauchen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.“ Dem Unternehmen ist es ein Anliegen, die Perspektiven und Erfahrungen der Patient:innen immer mitzunehmen, auch bereits in der Phase der Forschung & Entwicklung. „Bei uns gilt die Devise: ‚Nichts für mich ohne mich‘“, betont Boschetto.
Frühzeitig beginnen
Mag.a Katharina Klajnert, Head of Market Access & Government Affairs bei GSK Österreich, weist auf den Unterschied zwischen Gesundheitsförderung und Prävention hin: „Unter den weiten Begriff der Gesundheitsförderung fallen allgemeine Maßnahmen zur Stärkung des Wohlbefindens eines Individuums, wie z.B. gesunde Ernährung und Bewegung, aber auch mentale Aspekte. Bezüglich Gesundheitsförderung sollte in Kindergärten und Schulen viel mehr passieren, um eine solide Basis zu legen.“ Mag.a Dr.in Edith Flaschberger, Health Expert am Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Gesundheitssystem, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), und fachliche Leiterin der Koordinationsstelle der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK), ergänzt: „Es geht bei der Gesundheitsförderung immer auch um gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Das heißt, gemäß der WHO soll die gesündere Entscheidung die einfachere Entscheidung sein.“
Der engere Terminus „Prävention“ hingegen bezieht sich auf die Vermeidung von Krankheiten. Dabei können drei Bereiche unterschieden werden:
Die Primärprävention dient dazu, Krankheiten von vornherein möglichst zu verhindern, z.B. durch Impfungen – „hier gibt es viel ungenutztes Potenzial“, so Klajnert.
Sekundärprävention zielt darauf ab, Erkrankungen möglichst frühzeitig zu erkennen, z.B. über Screeningprogramme. Tertiärprävention kommt schließlich zum Tragen, wenn bereits eine Erkrankung vorliegt und man durch Präventionsmaßnahmen versucht, die Auswirkungen der Krankheit möglichst zu minimieren. „Zur Tertiärprävention gehören beispielsweise auch Reha-Maßnahmen, aber eigentlich sollten wir viel früher ansetzen, auch aus Kostengründen.“ Klajnert hält einen verstärkten Fokus auf Prävention nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels für sehr wichtig: „Derzeit sind rund 25% der Bevölkerung über 65 Jahre alt, bis 2050 werden es bereits 40% sein. Der Anteil der über 80-Jährigen, der derzeit bei 4% liegt, wird sich in den nächsten 20 Jahren sogar verdoppeln“, skizziert sie die zukünftige Situation. „Dies stellt das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen, u.a. durch steigende Kosten. Wir müssen uns daher mehr in Richtung Prävention bewegen“, betont Klajnert. Ihrer Ansicht nach kann die Stärkung der Gesundheitskompetenz hierbei einen wesentlichen Beitrag leisten, denn „ein fundiertes Verständnis über Gesundheit und Krankheit versetzt die Menschen in die Lage, Entscheidungen zu treffen und sich somit selbst um ihre Gesundheit zu kümmern – auch im Bereich Prävention“.
Anreizsystem schaffen
„Wir wissen alle, dass wir uns gesund ernähren und regelmäßig bewegen sollen. Je höher die Gesundheitskompetenz, desto eher wird jemand auf diese Aspekte achten“, ist auch MMag.a Astrid Jankowitsch, Head Public Policy, Communications & Patient Advocacy bei Takeda Pharma und Generalsekretärin des FOPI (Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie), überzeugt. Dies gilt ihrer Ansicht nach auch für die Teilnahme an Früherkennungsprogrammen und anderen Präventionsmöglichkeiten. Für Jankowitsch wäre diesbezüglich ein Anreizsystem – wenn man gewisse Aspekte beachtet, bekommt man Vergünstigungen – durchaus ein denkbarer Ansatz: „Wir müssen die Menschen dazu bringen, dass sie selbst etwas für ihre Gesundheit tun – und sie müssen es gerne tun! Dazu kann das Wissen über gesundheitliche Folgen von Handlungen oder eben Nicht-Handlungen viel beitragen.“
Auch Flaschberger unterstreicht, dass „geringe Gesundheitskompetenz dazu führt, dass Präventionsangebote weniger in Anspruch genommen werden“. Angesichts der derzeit herrschenden Gesundheitskompetenz wäre es daher sinnvoll, z.B. Schreiben, die zur Teilnahme an Präventionsmaßnahmen wie Vorsorgeuntersuchungen etc. auffordern, so aufzubauen, dass sie auch vermitteln, warum diese Maßnahme wichtig sein kann, was dadurch verhindert bzw. erreicht werden kann und auch, was nicht – und das in einer Art und Weise, dass es die Zielgruppe versteht. „Anreizsysteme sollte es zudem auch dafür geben, die Rahmenbedingungen für Gesundheit zu stärken – z.B. für Betriebe, die ihre Belegschaft gesund verpflegen oder die aktive Mobilität zur Arbeit fördern und dadurch zusätzlich etwas für das Klima tun.“
Jankowitsch sieht einen Vorteil von höherer Gesundheitskompetenz auch darin, dass Diagnosepfade verkürzt werden und Patient:innen dadurch früher in Behandlung kommen. „Dies ist auch ein Aspekt von Prävention, da so ein Fortscheiten der Erkrankung und eventuelle Folgeerkrankungen verhindert werden“, erklärt sie.
Wissen, Motivation, Fähigkeiten
Für Dr. Jürgen Soffried, MPH, Senior Consultant im Fachbereich Public Health am Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH (IfGP), Kompetenzzentrum der Sozialversicherung, ist Gesundheitskompetenz in der Krankenversorgung besonders dringlich: „Wer Leidensdruck hat, ist in aller Regel motiviert etwas zu tun. Motivation allein führt aber noch nicht zu gut informierten Entscheidungen.“ Soffried hebt hervor, dass die Gesundheitskompetenz auf drei Dingen fußt: Wissen, Motivation und Fähigkeiten müssen zusammenkommen. „Nehmen wir das Präventionsbeispiel Rauchstopp: Raucher:innen wissen, dass Rauchen ungesund ist. Der Rauchstopp scheitert also nicht am fehlenden Wissen, sondern an einem Mangel an Motivation und/oder an fehlenden Fähigkeiten, den Rauchstopp durchzuziehen“, so Soffried. Neben der Trias aus Wissen, Motivation und Fähigkeiten spiele auch die Selbstwirksamkeitserfahrung eine wichtige Rolle: „Wenn man erlebt hat, dass eine bestimmte Maßnahme – z.B. Ernährungsumstellung – etwas Positives bewirkt hat, erhöht dies die Motivation und man kann in Zukunft auf bestehende Fähigkeiten zurückgreifen“, erklärt Soffried und fasst nochmals zusammen: „Wer mit einer gut informierten Entscheidung zufrieden war, wird sich wieder gut informiert entscheiden wollen.“