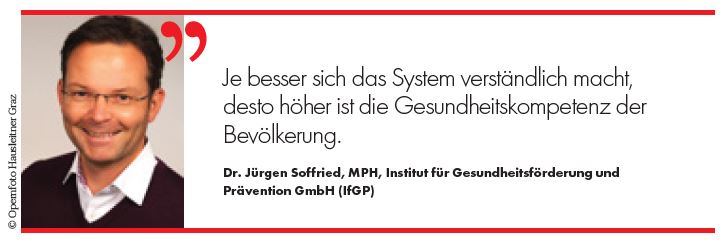Wie gesundheitskompetent ist Österreich?
“Gesundheitskompetenz wird in allen Lebenslagen gebraucht – von der Entscheidung über den Lebensmitteleinkauf, das Ausmaß täglicher Bewegung, den Umgang mit Stressoren, die Inanspruchnahme präventiver Angebote wie Impfungen oder Vorsorgemaßnahmen bis hin zum Umgang mit bestehenden Beeinträchtigungen und Erkrankungen“, betont Mag.a Dr.in Christina Dietscher, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Sektion VI – Humanmedizinrecht und Gesundheitstelematik) und Leiterin des Kernteams der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK). Denn Gesundheitskompetenz befähigt uns, in den Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention und Krankheitsbewältigung Entscheidungen treffen zu können, die unsere Gesundheit und Lebensqualität erhalten oder verbessern.
Damit Menschen dies tun können, brauchen sie Wissen, Motivation und die Fähigkeit, relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und im Alltag anzuwenden. Diese Gesundheitskompetenz aufseiten des Individuums muss dann noch mit den Anforderungen, mit denen die Menschen in diesen Bereichen konfrontiert sind – sprich, den Anforderungen des Systems –, im Zusammenspiel funktionieren. In Österreich gelingt dies seit Jahren bei einem Großteil der Bevölkerung nur unzureichend.
Health Literacy: Status quo in Österreich
2011 wurde die erste europäisch-vergleichende Erhebung zum Thema „Health Literacy“ durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten in Österreich bei 56% der Bevölkerung mangelhafte Gesundheitskompetenz. Dies führte dazu, dass die Stärkung der Gesundheitskompetenz als eines der zehn Gesundheitsziele festgelegt und die Österreichische Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK) gegründet wurde. Die ÖPGK koordiniert, unterstützt und entwickelt die Umsetzung des Gesundheitsziels „Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken“.
Um zu überprüfen, ob die ergriffenen Maßnahmen bereits Wirkung gezeigt haben, wurde im Jahr 2020 eine weitere Untersuchung durchgeführt (HLS19-AT). Diese war Teil des internationalen Health Literacy Population Survey 2019–2021 (HLS19) mit insgesamt 17 teilnehmenden Ländern. Für Österreich ergab die Erhebung, dass sich die Health Literacy um 5% verbessert hatte. Diese Verbesserungen im Informationsmanagement sind bei der Gesundheitsförderung sowie beim Beurteilen und Anwenden von Gesundheitsinformationen zu erkennen. Besondere Herausforderungen bestehen jedoch immer noch hinsichtlich Gesundheitsinformationen in den Medien, Informationen zu Therapien und Behandlungen, Informationen zum Umgang mit psychischen Problemen, beim Beurteilen und Anwenden von Gesundheitsinformationen sowie bei Informationen zur Prävention.
Erstmals wurden für HLS19-AT auch Daten in Bezug auf die digitale, die kommunikative und die navigationale Gesundheitskompetenz sowie die Gesundheitskompetenz in Bezug auf Impfungen erhoben. Es zeigte sich, dass die größten Herausforderungen bei der navigationalen und digitalen Gesundheitskompetenz bestehen.
„Heute weisen noch immer 47% der Bevölkerung eine niedrige Gesundheitskompetenz auf“, berichtet Dietscher. Dies habe gravierende Folgen – für das Individuum, aber auch für das Gesundheitssystem. „Menschen mit niedriger Gesundheitskompetenz haben ein höheres Risiko, im Laufe des Lebens mehr gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erfahren, können eigene gesundheitliche Probleme weniger gut benennen und beschreiben, aber auch Empfehlungen und Behandlungsanweisungen weniger gut verstehen und befolgen. Dies führt zu einem höheren Bedarf an Notfallbehandlungen, mehr ungeplanten stationären Wiederaufnahmen und mehr Komplikationen. Niedrige Gesundheitskompetenz ist – konservativ geschätzt – für ca. 3% der Behandlungskosten verantwortlich“, so Dietscher.
Gut informiert entscheiden (können)
Für Dr. Jürgen Soffried, MPH, Senior Consultant im Fachbereich Public Health am Institut für Gesundheitsförderung und Prävention GmbH (IfGP), Kompetenzzentrum der Sozialversicherung, ist „Gesundheitskompetenz“ eine schlechte Übersetzung des englischen Begriffs „Health Literacy“. Er spricht lieber von „gut informiert entscheiden“. Laut Soffried zeigt sich das Ausmaß der Gesundheitskompetenz immer dann, wenn Individuen und System aufeinandertreffen: „Das heißt, wenn jemand betreffend Krankheitsversorgung, Gesundheitsförderung oder Prävention etwas aus dem Gesundheitssystem benötigt, wird deutlich, wie hoch seine Gesundheitskompetenz ist, sprich, wie gut er oder sie sich im System zurechtfindet – und auch, wie einfach oder schwierig das System es ihm oder ihr macht“, erklärt Soffried. Es liegt also nicht nur an den Individuen, sondern auch am System, auf welchem Level sich die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung befindet.
Das System orientierend gestalten
Mag.a Dr.in Edith Flaschberger, Health Expert am Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Gesundheitssystem, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), und fachliche Leiterin der Koordinationsstelle der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK), betont ebenfalls, dass sich Gesundheitskompetenz aus der individuellen Kompetenz eines einzelnen Menschen und den Rahmenbedingungen zusammensetzt: „Es muss nicht nur eine einzelne Person Gesundheitskompetenz aufweisen, sondern das System selbst muss gesundheitskompetent sein. Das heißt, das System sollte so gestaltet sein, dass sich die Menschen darin gut zurechtfinden können.“ Dietscher stimmt zu: „Gesundheitskompetenz ist nicht nur eine Frage persönlichen Wissens und persönlicher Fähigkeiten, sondern hängt entscheidend davon ab, wie orientierend das Gesundheitssystem gestaltet ist, wie gut die Bevölkerung mit verlässlichen Gesundheitsinformationen versorgt ist und wie es um die Kommunikationsfähigkeiten der Gesundheitsberufe bestellt ist. Es gibt hier also auch eine Verantwortlichkeit des Gesundheitssystems.“
Determinanten der Gesundheitskompetenz
Generell sei für die Steigerung der Gesundheitskompetenz ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren erforderlich, so Flaschberger: „Man kann sich das wie ein Puzzle vorstellen, das sich aus mehreren Teilen zusammensetzt, die ineinandergreifen müssen.
Diese Teile sind: Gesundheitsinformationen, Gesprächsqualität, Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems und in Institutionen, Empowerment der Bürger:innen. Dies sind die Ansatzpunkte, über die man zu einer Steigerung der Gesundheitskompetenz beitragen kann.“
Mehr dazu lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Individuelle Vorteile und Entlastung des Systems
Statement Mag.a Dr.in Christina Dietscher, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Sektion VI – Humanmedizinrecht und Gesundheitstelematik) und Leiterin des Kernteams der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK)
„Durch gute Gesundheitskompetenz könnte zum einen die Effizienz in der Krankenbehandlung gesteigert werden (bessere klinische Outcomes). Zum anderen könnte sie den Behandlungsbedarf reduzieren. In Österreich sind etwa 36% der Todesfälle auf Lebensstil-assoziierte Erkrankungen zurückzuführen. Durch gute Gesundheitsentscheidungen könnten diese vielfach verzögert werden und Betroffene könnten länger bei guter Gesundheit leben.
Das ist besonders wichtig, weil wir aufgrund der demografischen Entwicklungen grundsätzlich von einer steigenden Nachfrage nach Krankenbehandlungsleistungen ausgehen müssen – die Menschen werden älter und der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung steigt. Dadurch nimmt tendenziell auch der Bedarf an Gesundheitsleistungen zu. Zugleich werden aber auch die Arbeitskräfte im Gesundheitssystem älter. Wir benötigen daher dringend Maßnahmen, die das System entlasten, wie beispielsweise eine Stärkung der Gesundheitskompetenz.“