„Ablehnung des Alzheimer-Medikaments ist enttäuschend“
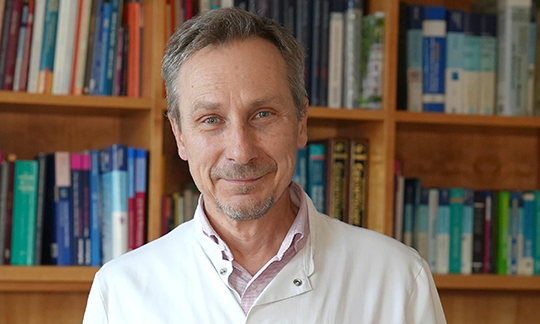 © SALK/Christine Walch
© SALK/Christine Walch Die EMA hat eine neue Alzheimer-Therapie unerwartet abgelehnt. Bernhard Iglseder, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie, erklärt, was das für die Versorgung in Österreich bedeutet.
Nachdem der Wirkstoff Lecanemab zur Alzheimer-Therapie in den USA zugelassen wurde, sprach sich die Europäische Arzneimittelagentur nun gegen eine Zulassung aus. Hat Sie das überrascht? Das kam schon unerwartet, denn in den USA wurde Lecanemab von der FDA (Anmerkung: Food and Drug Administration) 2023 sogar beschleunigt zugelassen. Der Grund für die Ablehnung der EMA liegt in der Bewertung des Verhältnisses von Nutzen und Nebenwirkungen. Hirn-Ödeme und -Blutungen traten relativ häufig, bei etwa zwölf bis 13 Prozent beziehungsweise 17 Prozent, auf. Nach dem Urteil der EMA zu häufig verglichen mit der beobachteten Wirksamkeit, also der Verzögerung des kognitiven Abbaus. Die Entscheidung ist also durchaus rational begründet. Die Herstellerfirma wird aber erneut um Zulassung ansuchen.
Das Medikament wurde von Expert:innen als „bahnbrechend“ beschrieben – warum? Auf der einen Seite hat es in diesem Bereich das letzte Mal vor rund 20 Jahren eine EMA-Zulassung gegeben. Auf der anderen Seite wirkt Lecanemab bereits in einem frühen Krankheitsstadium. Das ist in der Alzheimer-Therapie neuartig. Bei Alzheimer gibt es einen langen „stummen“ Vorlauf. Wenn sich erste Symptome zeigen, ist neuropathologisch schon relativ viel passiert. Die Idee, mit einem Antikörper möglichst früh einzugreifen, ist deshalb sehr spannend. Außerdem wurde erwartet, dass eine Zulassung helfen würde, eine Sensibilisierung für Frühsymptome zu erreichen sowie Bewusstsein für die Wichtigkeit von Früherkennung zu schaffen. Man hat also damit gerechnet, dass eine Empfehlung der EMA zu einem Umdenken im Bereich Alzheimer geführt hätte. Deshalb ist die Ablehnung enttäuschend. Was man aber dazu sagen muss ist, dass die praktische Umsetzung der Therapie schwierig gewesen wäre. Das hat sich auch in den USA gezeigt.
Inwiefern? Es ist eine sehr aufwendige Therapie, für die ein Amyloid-Nachweis erforderlich ist, der entweder über eine Lumbalpunktion mittels Liquordiagnostik gelingt oder über eine PET. Das wird bei vielen Patient:innen aus Ressourcenmangel nicht gemacht, zudem stellt sich die Herausforderung der Finanzierung. Die Therapie erfordert alle zwei Wochen eine Infusion, um das Medikament zu verabreichen. Das Monitoring der Therapie erfordert regelmäßige MRI-Untersuchungen. Das hat medizinisches Personal in den USA vor große Herausforderungen gestellt. Auch in Österreich haben wir die Ressourcen für Diagnostik und Behandlung so gar nicht. Auch wenn es kein Produkt für die Massen ist, sondern nur für einen kleinen Teil der Alzheimer-Patient:innen, denn das Medikament wurde lediglich für möglichst nicht multimorbide Patient:innen in einem frühen Stadium der Erkrankung getestet. Der Großteil der Alzheimer-Patient:innen ist aber älter und multimorbid.
Die Umsetzung wäre also trotz einer kleineren Zielgruppe schwierig? Wie schätzen Sie die Versorgung von Alzheimer-Patient:innen in Österreich grundsätzlich ein? Auch in Österreich hätten wir nicht genügend Personal, um Diagnostik und die neue Therapie für alle schnell zugänglich zu machen. Das ist aber ein Grundproblem der derzeitigen Versorgung. Über niedergelassene Fachärzt:innen und Memory Kliniken sind wir in Österreich grundsätzlich gut aufgestellt. Die Betreuung von Menschen mit Alzheimer benötigt aber auch qualifiziertes Personal: Pflegemangel und die Schwierigkeit, ambulante Dienste zu organisieren, stellen große Herausforderungen dar. Auch für eine institutionalisierte Betreuung fehlt das – hochspezialisierte – Personal, es gibt deswegen zu wenige Plätze. Und hier stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung, denn die Boomer-Generation geht nach und nach in Pension und wird mit fortschreitendem Alter kränker. Gleichzeitig fehlt der Nachwuchs in der Versorgung. Schätzungen zufolge soll sich die Anzahl der Menschen mit Demenz bis 2050 verdoppeln, also da kommt noch einiges auf uns zu. Und gerade hier wäre ein neues Medikament, das früh ansetzt und den Krankheitsverlauf verzögern kann, wirklich extrem hilfreich. Um noch einmal zum Anfang zurückzukommen: Die Entscheidung der EMA war bestimmt ein Rückschlag, aber im besten Fall gibt es in zwei, drei Jahren neue Studienergebnisse, die eine Neubewertung ermöglichen. (Das Interview führte Katrin Grabner)























































































