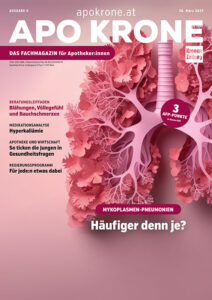Investieren wir jetzt in Gesundheitsreformen
 © Tanzer
© Tanzer Kassendefizite, Spardruck in den Spitälern und im niedergelassenen Bereich belasten Beschäftigte und Unternehmen. Doch Gesundheitsausgaben sind nicht nur Kosten, sondern auch Investitionen.
Der deutsche Bundestag hat am Dienstag ein Kreditpaket von 1000 Milliarden Euro für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz beschlossen. Dazu wurden Änderungen im Grundgesetz mit Zweidrittelmehrheit angenommen. Neben CDU, CSU und SPD hatten auch die Grünen angekündigt, das Vorhaben zu unterstützen. Bei Verteidigung und Infrastruktur gibt es in Deutschland einen riesigen Investitionsstau. Die Schuldenbremse wird jetzt gelockert, um nötige Investitionen zu tätigen, 100 Milliarden fließen in den Klimaschutz. Nun kann man darüber diskutieren, dass die Zinslast die laufenden Ausgaben belasten werden und eine Hypothek für die Zukunft darstellen. Andererseits sind Infrastrukturausgaben auch Investitionen, die wirtschaftsstärkend wirken können. Deutschland könnte eine Konjunkturlokomotive werden.
In jedem Fall zeigt das Beispiel, dass Schuldengrenzen oder Maastrichtkriterien fiktive Grenzen sind, die nicht in Stein gemeißelt sein müssen. Das kann auch für den Gesundheitsbereich gelten, wo ein Strukturumbau im niedergelassenen Bereich Investitionen erfordert. Hören wir auf, Gesundheitsausgaben immer nur als Kosten zu sehen. Wird mehr Geld für Straßenbau oder jetzt für Rüstung ausgegeben, nennt das ja auch niemand Kosten, sondern eine „Investition“. Doch die Beschäftigten und Unternehmen im Gesundheitswesen müssen sich ständig dafür verteidigen, was sie kosten und welche Kosten ihre Arbeit verursacht. Dabei ist das Gesundheitswesen selbst aufgrund seiner Größe ein wichtiger Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor.
Ursache für die Probleme im Gesundheitswesen sind sicherlich strukturellen Probleme und parallel Über- und Unterversorgung. Deren Ursache ist aber das seit Jahren von der Politik und ihren Berater:innen getrommelte Dogma, dass die Gesundheitsausgaben massiv steigen, das System zu teuer und ineffizient ist und deshalb gespart werden muss. Ja, wir geben mehr Geld für Gesundheit aus. Vor allem deshalb, weil wir als Gesellschaft auch reicher geworden sind. Weil Löhne und Gehälter und die Preise medizinischer und pharmazeutischer Produkte gestiegen sind. Allerdings ist der BIP-Anteil der Gesundheitsausgaben seit zehn Jahren fast stabil. Bei gleichzeitig steigender Bevölkerung, medizinischem Fortschritt und der demographischen Entwicklung bedeutet die BIP-Stagnation defacto, dass immer weniger Geld im Gesundheitswesen zur Verfügung steht. Die Folge: Personal steht unter Druck, Spitäler sperren Stationen, Wartezeiten steigen und Puffer für Krisenzeiten werden abgebaut mit der Hoffnung, dass die Krisen nie eintreten. Seit 2020 sehen wir aber das Gegenteil: Krisen nehmen zu. Auf Corona folgen die wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges und die ersten, deutlich sichtbaren Folgen der Klimakrise. Der Weg Deutschlands könnte einen mutigen Ausweg zeigen. (rüm)