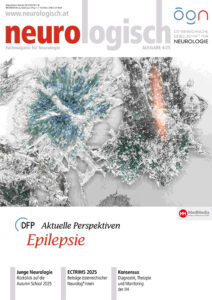Onkologische Notfälle
Für das Jahr 2013 werden in Deutschland ca. 500.000 neue Krebserkrankungen erwartet (www.rki.de). Durch verbesserte Therapieoptionen steigt die Lebenserwartung onkologischer Patienten stetig an. Dies führt unweigerlich zu einer Zunahme von Notfällen, die mit onkologischen Grunderkrankungen im Zusammenhang stehen. Häufig sind onkologische Notfälle Ausdruck einer fortgeschrittenen Krebserkrankung bzw. Folgen der Therapie und mit einer reduzierten Lebenserwartung verbunden. Die Versorgung dieser Notfälle hat oftmals eine palliative Zielsetzung (Symptomlinderung, Verbesserung der Lebensqualität, eventuell Lebensverlängerung). Onkologische Notfälle können aber auch die erste Manifestation sein und führen dann zur Erstdiagnose einer hämatologischen onkologischen Systemerkrankung. Das Vorliegen eines onkologischen Notfalls schließt eine Heilung von der malignen Grunderkrankung nicht aus1. Eine effiziente Diagnose onkologischer Notfälle und ein effektives Management der oft lebensbedrohenden Zustände ist ein entscheidender Bestandteil einer optimalen onkologischen Versorgung. Dies gilt sowohl bei kurativer als auch bei palliativer Zielsetzung.
Im Folgenden werden einige der häufigsten onkologischen Notfälle besprochen.
Vena-cava-superior-Syndrom
Das obere Vena-cava-superior-Syndrom (OVCS) ist durch eine Obstruktion der oberen Hohlvene mit einer venösen Rückflussstörung gekennzeichnet. Maligne Grunderkrankungen sind eine sehr häufige Ursache eines OVCS-Syndroms2, dies durch Kompression oder Infiltration von Tumormassen, durch malignomassoziierte Thrombosen mit Teil- oder Totalverschluss der Vena cava oder auch durch entzündliche Prozesse. Ein beträchtlicher Anteil von onkologischen Patienten mit OVCS-Syndrom (20–40 %) hat zum Entstehungszeitpunkt einen zentralvenösen Katheter3. In USA werden ca. 15.000 Patienten pro Jahr mit einem OVCS-Syndrom identifiziert2.
Die häufigsten Malignome, die zu einem OVCS-Syndrom führen können, werden in Tabelle 1 zusammengefasst.
Klinik
Je nach Ätiologie der Obstruktion entstehen zumeist über mehrere Wochen durch den Blutrückstau venöse Umgehungskreisläufe über Venen der Thoraxwand sowie die Vena azygos. Bei raschem Verschluss oder rascher Verlegung z. B. durch eine Thrombose kann es zu einer akuten klinischen Verschlechterung kommen, häufig mit lebensbedrohender Instabilität. Oftmals aggraviert eine Thrombose den Zustand rasch. Die häufigsten Symptome des OVCS sind Ödeme der oberen Körperhälfte, insbesondere des Gesichts (60–100 %) und der Arme sowie distendierte Venen des Halses und des Thorax (50 %), klinisch als oberflächliche Venenzeichnung vor allem der Venen der Brustwand imponierend. Zwei Drittel der Patienten klagen über Dyspnoe, jeder zweite über Husten. 50 % aller Patienten mit OVCS entwickeln einen Pleuraerguss. Bei entsprechender Ausprägung kann es zu einer Einengung der Pharynx- und Larynxregion mit Schluckbeschwerden und inspiratorischem Stridor kommen4, 2. Unspezifische neurologische Symptome, wie z. B. Kopfschmerzen, Synkopen, Schwindel und Verwirrtheit, sind eher selten, stellen aber dann häufig eine Notfallsituation dar.
Diagnostik
Die klinischen Symptome sind meist wegweisend für die Diagnostik, den Beweis liefern bildgebende Verfahren. In der Regel bringt eine Computertomographie des Thorax nähere Aufschlüsse über die Ursache der Einflussstauung. Der zweite Schritt ist die Sicherung einer Gewebeprobe des Tumors, die durch bildgebungsgezielte Punktion, Thorakozentese, Mediastinoskopie oder Bronchoskopie erfolgen kann. Bei pathologischem Blutbild kann eine Knochenmarkpunktion auch ohne Tumorbiopsie rasch die Diagnose sichern. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte von einer zytoreduktiven Therapie Abstand genommen werden, um die Diagnose nicht zu verschleiern. Dies gilt auch für die Verabreichung von Kortikosteroiden, die zu erheblichen Problemen bei der histologischen Beurteilung von lymphatisch differenzierten Leukosen und Lymphomen führen können. Entgegen früheren Annahmen erhöhen invasive diagnostische Verfahren beim OVCS das Komplikationsrisiko nicht in relevantem Ausmaß2.
Therapie
Die zugrunde liegende Erkrankung und das Ausmaß der Symptomatik des OVCS bestimmen die Therapie. Je nach Art des Malignoms sind eine Radiatio und/oder eine Chemotherapie indiziert. Eine rasch wirksame Therapieoption stellt das endovaskuläre Stenting der betroffenen Gefäßabschnitte dar. Dies kann aber häufig nur in spezialisierten Zentren durchgeführt werden. Indikation für ein Stenting besteht bei schweren Symptomen, wie Atemwegsobstruktion oder zerebralem Ödem. Begleitend sollte die Indikation für eine therapeutische Antikoagulation geprüft werden. Insbesondere im Zusammenhang mit kurativen Therapieansätzen kommen chirurgische Verfahren zur Anwendung. Diuretika, Kortikosteroide sowie die Hochlagerung des Oberkörpers können zu einer Symptomlinderung führen, wobei es für diese Maßnahmen nur wenig Evidenz gibt2.
Prognose
Das Überleben der Patienten wird durch den Verlauf der Grunderkrankung bestimmt. Das mediane Überleben liegt bei etwa 6 Monaten. Heilungen sind jedoch, in Abhängigkeit vom Primärtumor, prinzipiell möglich2, da besonders bei nichtsoliden onkologischen Tumoren, wie z. B. Lymphome, akute lymphatische Leukämie etc., der Therapieansatz kurativ ist. Daher sollte das Therapiemanagement rasch und effektiv erfolgen.
Malignes spinales Kompressionssyndrom
Das maligne spinale Kompressionssyndrom (MSCS) tritt bei etwa 5 % der Patienten mit einem fortgeschrittenen Malignom auf5. Gekennzeichnet ist das MSCS durch ein verdrängendes Wachstum vertebrogener Tumoren oder Metastasen, die in den Epiduralraum einwachsen und zu einer Kompression des Rückenmarks oder der Spinalwurzeln führen. Dies führt zu entsprechenden neurologischen Ausfällen und häufig zu – meist massiven – Schmerzen im betroffenen Areal.
Ursache
Die häufigsten mit einem MSCS assoziierten Tumoren sind Lungen-, Mamma- und Prostatakarzinome (15–20 %). Multiples Myelom, Non-Hodgkin-Lymphome und Nierenzellkarzinome sind in nur 5–10% der Fälle verantwortlich. Abhängig vom Primärtumor finden sich eher Metastasen im Bereich der thorakalen Wirbelsäule (Bronchialkarzinom, Mammakarzinom) oder eher im lumbosakralen Anteil der Wirbelsäule (Prostata etc.)5.
Klinik
Erste klinische Zeichen eines MSCS sind Schmerzen, die teils langsam zunehmend, aber auch akut auftreten können. In 40–90 % der Fälle kommen sensomotorische Plegien bzw. Ausfälle hinzu, entsprechend den korrespondierenden Nervenwurzeln. Viele Patienten bieten eine seitenungleiche motorische Schwäche der unteren Extremitäten bis hin zu Gehunfähigkeit. 50 % der Patienten zeigen Sensibilitätsstörungen und Inkontinenz. Bei Vorliegen einer Kompression der Cauda equina kommt es zu reduzierter Sensibilität der Glutealregion, der posterioren oberen Oberschenkel sowie zu einem Harnverhalt mit Überlaufblase und eventuell zusätzlicher Stuhlinkontinenz1.
Diagnostik
Bei neurologischen Ausfällen handelt es sich um einen Notfall, und es sollte unverzüglich die Diagnostik eingeleitet werden. Goldstandard in der Diagnostik und Bewertung eines MSCS ist das MRT mit einer Sensitivität von 93 % und einer Spezifität von 97 %. Konventionelle Röntgenaufnahmen sind nur eingeschränkt verwertbar1.
Therapie
Die Therapie sollte unmittelbar nach Diagnosestellung eingeleitet werden, um irreversible Schäden zu vermeiden. Ziel ist der Erhalt beziehungsweise die Wiederherstellung der Gehfähigkeit, der Kontinenz sowie eine Reduktion von Schmerzen und auffälligen anderen neurologischen Defiziten.
Kortison: Kortison ist Standard in der Akuttherapie des MSCS. Damit kann das Ödem und eventuell auch die Tumormasse (z. B. Lymphome) verringert werden. Begonnen wird mit Boli von 10 bis 16 mg i.v., gefolgt von 16–24 mg/Tag in vierstündlichen Verabreichungsintervallen. Das Tapering beginnt während oder nach abgeschlossener Radiotherapie1.
Bestrahlung: Die Radiatio ist ein weiterer zentraler Baustein im Behandlungskonzept des MSCS. Dosis und Dauer wird durch die Strahlentherapeuten festgelegt. Die Strahlentherapie ist nach Studienlage effektiv, stellt aber keine Akutintervention dar.
Operation: In ausgewählten Fällen stellt die Operation bzw. Dekompressionschirurgie eine Alternative dar. Dies gilt für Tumoren mit schwacher Strahlensensibilität oder einzelne nur lokal stenosierende Prozesse.
Chemotherapie: Eine Chemotherapie hat in der Akuttherapie keine Bedeutung, da nur langsame Therapieeffekte zu erwarten sind. Als Add-on-Therapie muss, abhängig vom individuellen Zustand des Patienten, eine Chemotherapie diskutiert werden.
Prognose
Die Prognose hängt entscheidend von einer schnellen und adäquaten Therapie ab. 90 % der Patienten, die initial gehen konnten, bleiben mobil. Daher ist eine rasche Diagnosesicherung unabdingbar, um eine schnelle Therapie einzuleiten. Abhängig von der zugrunde liegenden Tumorart ist ein MSCS häufig Ausdruck einer fortgeschrittenen Krebserkrankung. Heilung ist aber prinzipiell möglich.
Zerebrale hämatoonkologische Raumforderungen
Intrakranielle Tumore sind in den meisten Fällen Metastasen unterschiedlicher Primärtumoren. Die Folge von Gehirnmetastasen ist eine Verdrängung der regulären Gehirnsubstanz mit Auftreten eines perifokalen Ödems und eventueller Erhöhung des intrakraniellen Drucks. Eine tumorbedingte Liquorabflussbehinderung kann zu einem Hydrozephalus führen, und es kann zu Einblutungen kommen1, 6.
Ursache
Während Lungenkarzinome und Melanome häufig multiple Läsionen verursachen, führen Mamma-, Kolon- und Nierenzellkarzinome oftmals zu solitären Läsionen. Die hämatogen eingewanderten Metastasen befinden sich zumeist supratentoriell und überproportional häufig am Übergang von der grauen zur weißen Substanz.
Klinik
Drei von vier Patienten weisen zum Zeitpunkt der Diagnose von Gehirnmetastasen Symptome wie Cephalgien (50 %), fokal neurologische Defizite unterschiedlichster Ausprägung, epileptische Krampfanfälle (25 %) bis hin zum Status epilepticus, kognitive Störungen sowie Veränderungen der Persönlichkeit auf. Gehirnmetastasen werden zum Notfall, wenn ein erhöhter intrakranieller Druck zu Übelkeit, Erbrechen und Cephalgien führt. Des Weiteren können allgemeine Schwäche, Ataxie, Wesensveränderungen und Vigilanzschwankungen auftreten6.
Diagnostik
Das MRT ist die Diagnostik der Wahl, um Gehirnmetastasen zu sichern. In Akutsituationen ist eine Schädel-CT meist ausreichend, um große Metastasen, erhöhten Hirndruck, Abflussstörungen oder Blutungen nachzuweisen. Die Spiegelung des Augenhintergrundes kann hilfreich sein, um einen erhöhten intrazerebralen Druck zu identifizieren. Eine Liquorpunktion bei fehlendem Hirndruck kann die Dignität von unbekannten zerebralen Raumforderungen sichern.
Therapie
Kortikosteroide spielen bei der Akutbehandlung von zerebralen Metastasen mit erhöhtem Hirndruck die wichtigste Rolle. Dexamethason führt in der Regel innerhalb von 24 Stunden zu einer Besserung der Symptome. Die empfohlenen initiale i. v. Dosis von Dexamethason liegt zwischen 6 und 24 mg, gefolgt von 6-stündlichen Gaben zu jeweils 4 mg. Weiterhin kann die Gabe von Mannitol i. v. erfolgen. Operative Therapieoptionen im Sinne einer Dekompressionsmaßnahme sind nur in ausgewählten Fällen (solitäre Metastase) eine Möglichkeit. Je nach Art des Tumors und Strahlensensibilität ist für die Radiatio eine gute Langzeittherapieoption. Weitere Optionen sind die stereotaktische Bestrahlung oder das so genannte CyberKnife. Bei ausgewählten Malignomen (Lymphome, Keimzelltumoren, kleinzellige Karzinome) ist eine Langzeitchemotherapie sinnvoll. Bei Auftreten von zerebralen Krämpfen bis hin zu einem Status epilepticus kommen bevorzugt Benzodiazepine zum Einsatz. Eine Primärprophylaxe wird zurzeit nicht empfohlen7.
Prognose
Das mediane Überleben bei Vorliegen von Gehirnmetastasen ist abhängig vom Karnofsky-Performance-Status, der systemischen Ausbreitung sowie dem zugrunde liegenden Primärtumor. Es liegt ohne Therapie bei einem Monat. In Abhängigkeit von der malignen Grunderkrankung kann eine Therapie zumeist das Leben verlängern und die Lebensqualität verbessern. Beispielsweise erhöht die Ganzhirnradiatio die mediane Überlebenszeit von 1–2 auf 3–6 Monate. Für einige Tumorentitäten, wie Keimzelltumoren und Lymphome, existieren kurative Therapieansätze8.
Malignitätsassoziierte Elektrolytstörungen
Grundsätzlich können alle Elektrolyte im Rahmen einer Tumorerkrankung verändert sein und akute Notfallsituationen hervorrufen. Im Folgenden sollen die zwei wichtigsten und häufigsten Elektrolytstörungen besprochen werden.
Hyponatriämie
Eine Hyponatriämie besteht definitionsgemäß bei Serumnatriumwerten < 136 mmol/l. Unterschieden werden leichtgradige (135–131 mmol/l), mittelgradige (130–126 mmol/l) sowie schwergradige Formen (≤= 126 mmol/l). Die Ursachen für Hyponatriämien sind mannigfaltig, deren Mechanismen komplex.
Ursache: Hyponatriämie kann die Folge einer Volumendepletion durch Erbrechen, Diarrhö und verminderte perorale Flüssigkeitsaufnahme sein. Bei jeder Hyponatriämie sollte bedacht werden, dass eine verminderte Flüssigkeitsaufnahme oft Folge der Grunderkrankung oder der oftmals stark emetogenen Chemotherapeutika ist.
Ein häufiger Grund für eine Hyponatriämie ist das Syndrom der inadäquaten Sekretion von antidiuretischem Hormon (SIADH). Eine Vielzahl von Tumoren können antidiuretisches Hormon (ADH) produzieren, allen voran kleinzellige Bronchialkarzinome, deutlich seltener aber auch Karzinome des Gastrointestinal- und Urogenitaltrakts sowie des HNO-Bereichs. Auch diverse Chemotherapeutika, beispielsweise Cisplatin, Vincristin und Ifosfamid können zu einer gesteigerten Freisetzung von ADH aus dem Hypophysenhinterlappen führen. Die Folge ist eine vermehrte renale Rückresorption von Wasser über Aquaporine des renalen Sammelrohrs und damit eine hypotone Hyponatriämie. Um die Euvolämie zu erhalten, wird kompensatorisch vermehrt Natrium und Wasser ausgeschieden, die Hyponatriämie wird verstärkt.
Neben Krebserkrankungen kann eine Vielzahl von anderen Faktoren zum SIADH führen, darunter zerebrale Prozesse (z. B. Infektionen, Insulte, multiple Sklerose), pulmonale Prozesse (z. B. Pneumonien, Tuberkulose oder Asthma) sowie als häufige Auslöser Psychopharmaka (insbesondere Serotonin-Reuptake-Hemmer), schwere Übelkeit und (postoperative) Schmerzen9.
Klinik
Eine leichtgradige Hyponatriämie verläuft zumeist asymptomatisch. Dasselbe trifft oft auch auf höhergradige Hyponatriämie zu, sofern sie nicht akut auftritt. Bei symptomatischen Patienten können Vigilanzveränderungen im Sinne von ausgeprägter Müdigkeit, Konzentrations- und Merkschwächen sowie Veränderungen der Persönlichkeit erste Anzeichen sein. Eine rasch aufgetretene bzw. ausgeprägte Hyponatriämie ist ein potenziell lebensgefährliches Krankheitsbild mit Verwirrung, Halluzination, Cephalea, Übelkeit, epileptischem Krampfgeschehen und potenziell tödlichem Ausgang.
Diagnostik
In der Diagnostik des SIADH ist die Harnuntersuchung von zentraler Bedeutung: Wesentliche Parameter sind Harnosmolalität und Harnnatrium. Bei niedriger Serumosmolalität ( 100 mOsm/kg). Typisch ist ein erhöhtes Harnnatrium (> 40 mmol/l). Dieser Befund ist jedoch nicht spezifisch und kann durch mehrere Faktoren hervorgerufen werden, beispielsweise durch die Verabreichung von Diuretika. Klinisch besteht Euvolämie. Das heißt, in Abwesenheit anderer Erkrankungen haben die Patienten in der Regel keine Anzeichen einer Exsikkose oder Überwässerung (wie z. B. kardiopulmonale Stauungszeichen oder periphere Ödeme). Ein typischer Befund ist ein niedriger Harnsäurewert (ganz im Gegensatz zu einer z. B. diuretikainduzierten Hyponatriämie).
In der Regel reicht die genannte Befundkonstellation in Zusammenschau mit der Klinik aus, um die Diagnose eines SIADH stellen zu können, vor allem dann, wenn bereits eine entsprechende Tumorerkrankung bekannt ist. Die ADH-Spiegel müssen nicht routinemäßig bestimmt werden. Differenzialdiagnostisch sollte eine Hypothyreose ausgeschlossen werden.
Therapie
Neben der Therapie der Grunderkrankung bzw. des kausalen Auslösers (Erbrechen etc.) steht die Substitution von Natrium im Mittelpunkt der Therapie. Dabei ist ein langsamer Ausgleich wichtig. Als Faustregel kann ein Ansteigen von maximal 0,5 mmol/l pro Stunde gelten. Andernfalls besteht die Gefahr einer zentralen pontinen Myelinolyse (ZPM). Bei rasch aufgetretener schwerer Hyponatriämie kann auch ein rascherer Ausgleich erwogen werden. Je nach Urinosmolarität (meist deutlich > 400 mosmol) muss ein Ausgleich mit 3%-NaCl-Lösung erfolgen (eine 0,9%-ige NaCl-Lösung kann unter Umständen die Hyponatriämie verstärken!). Eine langfristige Therapie kann danach mit einem selektiven ADH-Antagonisten erfolgen (Vaptane, z. B. Tolvaptan®)10. Die Therapie sollte interdisziplinär onkologisch, nephrologisch und intensivmedizinisch erfolgen.
Prognose
Die Mortalität der schweren Hyponatriämie liegt bei 10–50 % und ist weitestgehend unabhängig von der Grunderkrankung.
Hyperkalzämie
Malignomassoziierte Hyperkalzämien (MAH) treten bei 25 % der Krebspatienten auf. Mehr als ein Drittel der Patienten sucht wegen Beschwerden im Rahmen einer MAH eine Notfallaufnahme auf11, 12.
Ursache
Ursachen einer MAH können sein:
- ein Malignom, das ein PTH-related Protein induziert,
- eine lokale Osteolysen durch Knochenmetastasen,
- eine lymphomassoziierte Kalzitriol-Produktion oder
- eine ektope PTH-Sekretion5.
Klinik
Die Symptomatik der malignominduzierten Hyperkalzämie ist abhängig vom Serumkalziumgehalt. Bei einer leichten Hyperkalzämie, oft ein Zufallsbefund im Labor, sind die meisten Patienten beschwerdefrei. Erste klinische Zeichen einer Hyperkalzämie sind häufig Müdigkeit sowie Polyurie und Polydipsie als Folge der verminderten renalen Konzentrationsfähigkeit. Bei nicht ausreichendem Volumenersatz kann der vermehrte Flüssigkeitsverlust zur Exsikkose führen. Bei weiterem Kalziumspiegelanstieg kann es v. a. zu gastrointestinalen, renalen, neurologischen und kardialen Beschwerden kommen. Eine schwere Hyperkalzämie kann zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen, der unverzüglich behandelt werden muss.
Diagnostik
Durch die Bestimmung des Serumkalziums bei entsprechenden Symptomen fallen Verschiebungen sofort auf. Für die Symptomatik entscheidend ist das ionisierte, nicht proteingebundene Kalzium. Deswegen muss bei der Beurteilung des Schweregrades der Hyperkalzämie auch der Serumalbuminspiegel berücksichtigt werden. Bei einer Hypalbuminämie, die gerade bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen nicht selten besteht, kann z. B. der Anteil des ionisierten Kalziums unterschätzt werden. Hinsichtlich des klinischen Managements muss darauf hingewiesen werden, dass regelmäßig das im Rahmen von Blutgasanalysen bestimmte einwertige Kalzium als falsch niedriger Kalziumwert fehlinterpretiert wird.
Therapie
Die Prinzipien der Behandlung der tumorassoziierten Hyperkalzämie sind die Hemmung der Kalziummobilisierung aus dem Knochen, die Steigerung der Urinausscheidung, die Reduktion der enteralen Kalziumresorption und eine adäquate Behandlung der Tumorerkrankung. Bei den häufig dehydrierten Patienten ist die Rehydratation mit forcierter Diurese unter dem Einsatz von Schleifendiuretika Primärtherapie. Wichtig ist, vor dem Einsatz der Diuretika eine häufig bestehende Exsikkose auszugleichen (3–4 l), um die Nierenfunktion nicht weiter zu verschlechtern. Mit Kortison und Bisphosphonaten kann rasch die Kalziummobilisierung aus dem Knochen gehemmt werden. Der Wirkungseintritt der Bisphosphonate tritt erst nach 2–4 Tagen ein und hält ca. 2–4 Wochen an. Dies schafft Zeit für eine begleitende Radiatio-Chemotherapie. Bei lebensbedrohenden Komplikationen kann eine Akutdialyse zur raschen Normalisierung der Elektrolyte eingesetzt werden.
Prognose
Die Prognose wird durch die Symptome bzw. Komplikationen und die zugrunde liegenden hämatoonkologische Grunderkrankung bestimmt.
Tumorlyse-Syndrom
Das Tumorlyse-Syndrom (TLS) entsteht durch einen raschen Zerfall von Tumorzellen mit Austritt von Zellbestandteilen, was schwerwiegende systemische Konsequenzen nach sich ziehen kann. Insbesondere tritt es nach Beginn einer zytoreduktiven Therapie bei aggressiven hämatologischen Erkrankungen auf, zum Beispiel bei der akuten Leukämie und beim Burkitt-Lymphom. Allerdings kann ein TLS bei hochproliferativen Erkrankungen als Ausdruck des hohen Zellumsatzes auch spontan und unabhängig von zytoreduktiven Therapien auftreten. Wesentlich seltener ist ein TLS bei soliden Tumoren mit hoher Tumorlast und gutem Ansprechen auf zytoreduktive Therapien13, 14.
Ursache
Durch Tumorzellzerfall treten kurzfristig hohe Konzentrationen von Nukleinsäuren, Kalium und Phosphat auf, welche die exkretorische Kapazität der Niere überschreiten können. Nukleinsäuren werden umgehend in sehr schlecht wasserlösliche Harnsäure umgewandelt, die in verschiedenen Geweben auskristallisiert. Eine Kristallisation in den Nierentubuli kann zu renaler Dysfunktion und eventuell akutem Nierenversagen führen, wodurch die durch den Zellzerfall entstehende Hyperkaliämie potenziell aggraviert wird.
Klinik
Neben den Symptomen von Elektrolytentgleisungen kommt es durch Auskristallisierung der Harnsäure zu Störungen in diversen Organsystemen. Mögliche Folgen sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Überwässerung mit Ödembildung und Herzinsuffizienz bis hin zu Herzrhythmusstörungen, Muskelkrämpfen, Vigilanzstörungen, Synkopen, zerebralen Krampfanfällen und einem plötzlichen Herztod.
Diagnostik
Unterschieden wird das laborchemische TLS vom klinischen TLS. Ersteres wird definiert, wenn sich mindestens zwei der folgenden Laborwerte um mehr als 25 % gegenüber dem Ausgangswert verändern oder über bzw. unter den angegebenen Grenzwerten liegen:
- Serumharnsäure &re;= 8 mg/dl (≥ 476 μmol/l)
- Serumkalium &re;= 6,0 mmol/l (≥ 2,1 mmol/l)
- Serumphosphat &re;= 6,5 mg/dl (≥ 1,45 mmol/l)
- Serumkalzium ≤= 7 mg/dl (≤ 1,75 mmol/l)
Ein klinisches TLS liegt vor, wenn die Kriterien für ein laborchemisches Tumorlyse-Syndrom erfüllt sind und mindestens eine der folgenden pathologischen Veränderungen besteht:
- Serumkreatininanstieg (≥1,5 des Normalwertes)
- Herzrhythmusstörungen mit lebensbedrohenden Arrhythmien
- Neurologische Veränderungen bis hin zu epileptischen Anfällen
Die Schweregradklassifizierung nach den Cairo-Bishop-Kriterien findet sich in Tabelle 2.
Therapie
Im Vordergrund steht die Vermeidung des TLS. Daher ist die Gabe einer niedrig dosierten Chemotherapie bei Malignomen mit hoher Proliferationsrate im Sinne einer Vorphase überlegenswert.
Die Säulen der Therapie sind eine Diuresesteigerung durch adäquate Bewässerung bzw. den Einsatz von Diuretika sowie die Senkung des Harnsäurespiegels bei erhöhtem Risiko oder manifestem TLS13.
Flüssigkeitsmanagement: Aggressive i. v. Hydratation (2–3 l/m2) mit den Ziel, die Urinausscheidung auf 80–100 ml/m2/h zu steigern. Gegebenenfalls Einsatz von Diuretika. Cave: Überwässerung bei Niereninsuffizienz und Herzinsuffizienz. Zuvor Abklärung eines potenziellen postrenalen Nierenversagens bzw. einer Abflussstörung.
Harnsäuresenkung: Allopurinol verringert durch Hemmung der Xanthinoxidase die Harnsäurebildung, entfernt jedoch bereits zirkulierende Harnsäure nicht. Allopurinol wird bei intermediärem oder hohem Risiko und normalen Harnsäurewerten (≤ 7,5 mg/dl) in der Dosierung 100 mg alle 8 Stunden 1–2 Tage vor Beginn der zytoreduktiven Therapie verabreicht und 3–7 Tage (je nach Entwicklung des Risikoprofils) fortgesetzt. Bei eingeschränkter GFR muss die Dosis reduziert werden. Es bestehen klinisch bedeutsame Interaktionen mit 6-Mercaptopurinen beziehungsweise Azathioprin.
Rasburicase ist ein Äquivalent der Uratoxidase, eines Enzyms, das bei manchen Säugetieren die Umwandlung von Harnsäure in Allantoin katalysiert. Menschen fehlt dieses Enzym, es wird rekombinant hergestellt. Allantoin ist sehr gut wasserlöslich und wird über die Nieren ausgeschieden. Rasburicase wird als prophylaktische Maßnahme bei hohem Risiko für das Auftreten eines TLS bei Hyperurikämie und bestehendem „Labor-TLS“ oder TLS in der Dosierung 0,1–0,2 mg/kg empfohlen. Die Therapiedauer richtet sich nach den Harnsäurewerten. Rasburicase ist kontraindiziert bei Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel und induziert in zirka 10 % der Fälle spezifische Antikörper. Rasburicase muss bei Nierenfunktionsstörungen nicht dosisreduziert werden. Rasburicase entfaltet die Wirkung auch unter Raumtemperatur, so dass unter Therapie Blutabnahmeröhrchen unmittelbar nach der Gewinnung eisgekühlt werden müssen, um falsch negative Harnsäurewerte zu vermeiden.
Harnalkalisierung: Von einer routinemäßigen Harnalkalisierung, die viele Zentren zur Erhöhung der Harnsäurelöslichkeit durchführen, wird ausdrücklich abgeraten, da das Risiko für ein Ausfallen von Kalzium-Phosphat-Präzipitaten besteht und die Effektivität nicht gesichert ist. Bei metabolischer Azidose kann eine Harnalkalisierung jedoch erwogen werden.
Akutdialyse: In ausgewählten Fällen bzw. kardiopulmonaler Instabilität kann eine Akutdialyse in Erwägung gezogen werden. Zu bedenken ist die häufig parallel gegebene Chemotherapie unter Dialyse.
Prognose
Die Prognose hängt entscheidend von der Ausprägung des TLS und der entsprechenden Grunderkrankung ab (Tab. 2).