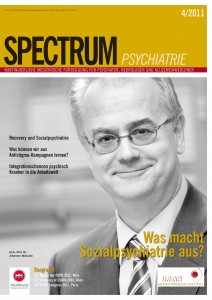Integrationschancen psychisch Kranker in die Arbeitswelt
Arbeitsrehabilitation für psychisch kranke Menschen
Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit hat negative Folgen für psychisch erkrankte Menschen, da ein Verlust der Tagesstruktur ebenso die Folge ist wie eine Ausdünnung der sozialen Kontakte, finanzielle Schwierigkeiten, gesellschaftliche Stigmatisierung und eine Verminderung des Selbstwertgefühls1. Umgekehrt berichten verschiedene Autoren, dass sich die klinische Symptomatik psychisch kranker Menschen unter Arbeitstherapie verbessert2– 4. Arbeit bzw. Arbeitstherapie führt darüber hinaus zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität bei Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen4–8. Nicht zuletzt geben die Betroffenen selbst einen hohen Leidensdruck durch Arbeitslosigkeit an und erwähnen das (Wieder-)Erlangen einer Beschäftigung als wichtiges Ziel9. Aus all diesen Beobachtungen ergibt sich die Notwendigkeit, über allgemeine medizinisch- rehabilitative Maßnahmen hinaus auch eine Rehabilitation psychisch Erkrankter in den Arbeitsalltag anzustreben.
„First train, then place“: Arbeitsrehabilitative Angebote lassen sich nach den Rahmenbedingungen der Betreuung (Betreuungsdichte, Art und Ort der Unterstützung, Anforderungsniveau bzw. Nähe zum allgemeinen Arbeitsmarkt) aufgliedern und reichen von arbeitstherapeutischen Maßnahmen in voll- und teilstationären Einrichtungen und Rehabilitationszentren über beschützte Werkstätten und spezielle Trainingsprogramme vor Eingliederung in den Arbeitsmarkt bis hin zur direkten Begleitung in den bzw. am ersten Arbeitsmarkt10. Verfügbare Untersuchungen beziehen sich in erster Linie auf eine erfolgreiche Integration in den allgemeinen, ersten Arbeitsmarkt. Hier werden – v. a. im englischsprachigen Raum – zwei große Ansätze der Arbeitsrehabilitation unterschieden. Zum einen die Methode des „First train, then place“ – hier nimmt der Klient an speziellen Trainingsprogrammen (z. B. soziales Kompetenztraining, Bewerbungstraining) teil und arbeitet zeitlich begrenzt an einem geschützten Arbeitsplatz (Arbeitstrainingsplatz mit reduzierten Anforderungen), bevor er in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert wird.
„First place, then train“: Zum anderen der Ansatz des „First place, then train“, bei dem der Klient schon in der ersten Phase der Rehabilitation in den ersten Arbeitsmarkt integriert und dort professionell unterstützt wird. Der erfolgversprechendste Ansatz ist nach heutigem Wissensstand eindeutig jener des „First place, then train“. Crowther et al. demonstrierten in einem systematischen Übersichtsartikel, in den die Ergebnisse von elf randomisierten, kontrollierten Studien Eingang fanden, die Überlegenheit des „First place, then train“-Ansatzes gegenüber der „First train, then place“-Methode11. In einer kontrollierten Studie mit 219 Patienten mit schwerer psychischer Erkrankung zeigte sich, dass Patienten, die zur „First place, then train“-Gruppe randomisiert worden waren, leichter Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt fanden und eine höhere Arbeitsleistung (mehr Arbeitszeit und höhere Löhne) erbrachten, jedoch ebenso wie die Patienten der Kontrollgruppe erhebliche Schwierigkeiten hatten, den Arbeitsplatz längerfristig zu behalten12.
Die Überlegenheit des sogenannten Individual- Placement-and-Support-(IPS)- Programms gegenüber herkömmlichen arbeitsrehabilitativen Maßnahmen bestätigte sich auch in einer amerikanischen Multicenter-Studie mit 1.273 Patienten und einer kanadischen randomisierten, kontrollierten Studie mit 150 schwer psychisch Erkrankten sowie in einer kleineren Untersuchung mit über 40-jährigen schizophrenen bzw. schizoaffektiven Patienten13. Zwischenzeitlich liegt auch für den europäischen und auch den deutschsprachigen Raum eine große kontrollierte Studie vor, die ebenfalls eindeutige Vorteile der direkten Vermittlung der Patienten in einen Job am allgemeinen Arbeitsmarkt im Gegensatz zu einem vorgeschalteten Training unter geschützten Bedingungen fand14.
Abgesehen vom Setting der Intervention prädizieren auch individuelle Eigenschaften den Rehabilitationserfolg15, ebenso wie die Gesamtsituation am Arbeitsmarkt (Höhe der Arbeitslosenrate, konjunkturelle Schwankungen) naturgemäß die Jobchancen für durch psychische Erkrankungen in der Leistungsfähigkeit ein – geschränkte Menschen beeinflusst. Ein Erfolg von Arbeitsrehabilitation hängt auch von den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen im Gesundheits- und Sozialrecht ab. Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, auf deren Basis sich die verfügbaren rehabilitativen Angebote etabliert haben, sind in den deutschsprachigen Ländern so verschieden, dass eine Vergleichbarkeit von Angeboten und deren Effizienz äußerst schwierig ist.
Die Situation in Österreich
In Österreich waren nicht mehr als 14 % der stationär psychiatrisch behandelten Patienten berufstätig16. Arbeitsrehabilitative Angebote sind in sehr unterschiedlicher Dichte und Verteilung vorhanden. Der Ausbaugrad spezifischer Unterstützungsangebote ist – bedingt durch historische Entwicklungen und sozialrechtliche Unterschiede – höchst inhomogen: Es existieren heute in geringer geographischer Entfernung Regionen, wo Nutzer Wahlmöglichkeit aus unterschiedlichen, fachlich ausdifferenzierten Angeboten haben, ebenso wie Gegenden, in denen Arbeitsrehabilitationsangebote für psychisch Erkrankte völlig fehlen. Es existiert weder eine qualitative noch eine quantitative Übersicht über die in Österreich verfügbaren Angebote. Die Mehrzahl der Angebote dürfte der „First train, then place“-Methode zuzuordnen sein, etwa manche Arbeitstrainingszentren, geschützte Werkstätten, Zuverdienstfirmen bis hin zu Tagesstätten, sofern diese beschäftigungsrehabilitative Ziele verfolgen. Insgesamt ist von einem Mangel an berufsrehabilitativen Einrichtungen auszugehen, der möglicherweise der sich weiter zuspitzenden Zuerkennung von Invaliditätspensionen aufgrund psychischer Störungen und Behinderungen zugrunde liegt.
Am Beispiel von Niederösterreich kann geschildert werden, dass die Gesamtanzahl an in Niederösterreich erforderlichen Arbeitsrehabilitationsplätzen vom ÖBIG auf 464 bis 773 (0,3 bis 0,5 Plätze je 1.000 Einwohner) geschätzt wurde, zuzüglich von 464 bis 618 (0,3 bis 0,4 je 1.000 Einwohner) Plätze für Tagesstrukturierung17. Die Anzahl der 2002 verfügbaren Arbeitstrainingsplätze betrug demgegenüber lediglich 90, zuzüglich 232 verfügbare Arbeitsassistenzplätze (Abdeckung des Bedarfs von lediglich 20 % oder von 69 %, sofern die allerdings ambulanten Leistungen der Arbeitsassistenz hinzugerechnet wurden) 18. Statt eines ausreichenden Angebots an Arbeitsrehabilitation sind eine Reihe von Tagesheimstätten verfügbar, die allerdings eher der Tagesstrukturierung und Kontaktfindung denn beschäftigungsrehabilitativen Zielen dienen. Werkstätten zum Arbeitstraining psychisch erkrankter Menschen sind in Niederösterreich nur in 3 von 7 Psychiatrieregionen etabliert. Es ist ein massiver Mangel festzustellen, der wohl zu einem unnötig hohen Anteil an frühzeitig pensionierten Personen führt.
Arbeitsassistenz: Einigermaßen flächendeckend ist in Niederösterreich ein der „First place, then train“-Methode vergleichbarer Ansatz verfügbar: Das Angebot der „Arbeitsassistenz“, wobei die professionelle Unterstützung am ersten Arbeitsmarkt hier aufgrund sozialrechtlicher Bestimmungen üblicherweise auf einen Zeitraum von maximal einem Jahr begrenzt ist. In einer aktuellen Evaluierung von Arbeitsrehabilitationseinrichtungen in Niederösterreich zeigte sich, dass Klienten, die an einem Programm der Arbeitsassistenz teilgenommen hatten, signifikant länger in regulärer Beschäftigung verblieben als die Klienten eines beschützenden Beschäftigungsprojektes, wobei hier zu erwähnen ist, dass bereits vor Beginn der Maßnahme signifikante Unterschiede in der Dauer der vorangegangenen Beschäftigung bestanden hatten19.
In der Regel konnten nur wenige Patienten die „geschützte“ Arbeitssituation in besonders gestalteten Werkstätten als „Sprungbrett“ in eine Beschäftigung unter Realitätsbedingungen nützen20, 21. Eine Nachuntersuchung eines Arbeits – trainingszentrums in Oberösterreich fand eine Integration am allgemeinen Arbeitsmarkt von 23 %, 38 % der Teilnehmer waren zwischenzeitlich pensioniert worden22.
Stationäre arbeitsrehabilitative Maßnahmen: In allen sozialpsychiatrischen Abteilungen sowie in Tageskliniken ist Ergotherapie heute fixer Bestandteil des therapeutischen Angebots. Zum Einfluss stationärer arbeitsrehabilitativer Maßnahmen auf den Rehabilitationserfolg ist wenig publiziert. Längle et al. konnten in ihrer Studie keinen signifikanten Unterschied in der Wirkung von arbeitstherapeutischen Maßnahmen und Ergotherapie im stationären Setting finden23. Die in Österreich in den vergangenen Jahren etablierten stationären medizinischpsychiatrischen Rehabilitationszentren, deren Strukturqualitätsparameter sehr positiv zu bewerten sind, könnten sich dämpfend auf die Zunahme der Zuerkennungen von Invaliditätspensionen auswirken – bislang sind allgemein zugängliche Berichte über die Effekte dieser Einrichtungen auf die weitere berufliche Integration der Rehabilitanden allerdings (noch) nicht verfügbar.
resümee
Die große Mehrzahl besonders der an schwereren psychischen Störungen erkrankten Menschen ist arbeits- bzw. beschäftigungslos. Der vielerorts in Österreich noch bestehende Mangel an ausdifferenzierten Angeboten zu beruflicher Rehabilitation wirkt sich negativ auf den Krankheitsverlauf aus. Wo Arbeitsrehabilitation angeboten und auch evaluiert wurde, zeigen sich die Chancen auf erfolgreiche Integration der Betroffenen in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
In Österreich sollte in den kommenden Jahren einerseits darauf Wert gelegt werden, dass dem Bedarf entsprechende arbeitsrehabilitative Angebote zur Verfügung stehen, diese also quantitativ insbesondere dort ausgebaut werden, wo die Versorgung mangelhaft bis gänzlich fehlend ist. Andererseits sollten in den verfügbaren Einrichtungen laufend Begleitevaluationen durchgeführt werden, um eine noch bessere Datenbasis für die weitere qualitative Gestaltung sowie für die Bedarfsplanung zu generieren.
1 Mueser KT, Salyers MP, Mueser PR, A prospective analysis of work in schizophrenia. Schizophr Bull 2001; 27:281-296
2 Bond Gr, Resnick SG, Drake RE, Xie H, McHugo GJ, Bebout RR, Does competitive employment improve nonvocational outcomes for people with severe mental illness? J Consult Clin Psychol 2001; 69 :489-501
3 Mueser KT, Becker DR, Torrey WC, Xie H, Bond GR, Drake RE, Bradley JD, Work and nonvocational domains of functioning in persons with severe mental illness: A longitudinal analysis. J Nerv Ment Dis 1997; 185:419-426
4 Bell MD, Fiszdon JM, Greig TC, Bryson GJ, Can older people with schizophrenia benefit from work rehabilitation? J Nerv Ment Dis 2005; 193:293-301
5 Bryson G, Greig T, Lysaker P, Bell MD, Quality of life benefits of paid work activity in schizophrenia: a longitudinal analysis. Schizophr Bull 2002; 28:249-257
6 Holzner B, Kemmler G, Meise U, The impact of work-related rehabilitation on the quality of life of patients with schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998; 33:624-631
7 Priebe S, Warner R, Hubschmid T, Eckle I, Employment, attitudes toward work, and quality of life among people with schizophrenia in three countries. Schizophr Bull 1998; 24:469-477
8 Kager A, Lang A, Berghofer G, Henkel H, Schmitz M, The impact of work on quality of life for persons with severe mental illness. Nervenheilkunde 2000; 19:560-565
9 Marhawa S, Johnson S, Schizophrenia and employment. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004; 39:337-349
10 Rössler W, Perspektiven der psychiatrischen Rehabilitation. Psychiatrie & Psychotherapie 2007; 3:3-8
11 Crowther RE, Marshall M, Bond GR, Huxley P. Helping people with severe mental illness to obtain work: systematic review. BMJ 2001; 322:204-208
12 Lehmann et al., 2002
13 Cook JA, Leff HS, Blyler CR, Gold PB, Goldberg RW, Mueser KT, Toprac MG, McFarlane WR, Shafer MS, Blankhertz LE, Dudek K, Razzano LA, Grey DD, Burke-Miller J, Results of a multisite randomized trial of supported employment interventions for individuals with severe mental illness. Arch Gen Psychiatry 2005; 62:505-512
14 Burns T, Catty J, Becker T, Drake RE, Fioritti A, Knapp M, Lauber C, Rössler W, Tomov T, van Busschbach J, White S, Wiersma D, for the EQOLISE group. The effectiveness of supported employment for people with severe mental illness: a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370:1146-1152
15 Matschnig T, Seyringer ME, Frottier P, Frühwald S, Arbeitsrehabilitation psychisch kranker Menschen – ein Überblick über Erfolgsprädiktoren. Psychiatrische Praxis 2008; 35:271-278
16 Wancata J, Gasselseder M, Müller C, Arbeit und Lebensqualität schizophrener Patienten. In: Katschnig H, König P: Schizophrenie und Lebensqualität, Springer Verlag, Wien, 1994.
17 Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen: Struktureller Bedarf in der psychiatrischen Versorgung. Wien, 1998
18 Katschnig H, Denk P, Weibold B, Evaluation des Niederösterreichischen Psychiatrieplans 1995
19 Frühwald S, Bühler B, Grasl R, Gebetsberger M, Matschnig T, König F, Frottier P, (Irr-)wege in die Arbeitswelt – Langzeitergebnisse arbeitsrehabilitativer Einrichtungen für psychisch Kranke der Caritas St. Pölten. Neuropsychiatrie 2006; 20:250-256
20 Hoffmann H, Kupper Z, Prädiktive Faktoren einer beruflichen Wiedereingliederung von schizophrenen Patienten. Psychiat Prax 2003; 30:312-317
21 Reker T, Krankheits- und Rehabilitationsverläufe schizophrener Patienten in ambulanter Arbeitstherapie. Nervenarzt 1998; 69:210-218
22 Rittmannsberger H, Atzlinger G, Ergebnisse beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen bei schizophrenen Patienten. In: Katschnig H, König P (Hrsg): Schizophrenie und Lebensqualität. Springer, Wien, New York, 203-214, 1994
23 Längle G, Bayer W, Köster M, Salize HJ, Höhl W, Machleidt W, Wiedl KH, Buchkremer G, Unterscheiden sich die Effekte stationärer Arbeits- und ergotherapeutischer Maßnahmen? Ergebnisse einer kontrollierten Multizenterstudie des Kompetenznetzes Schizophrenie. Psychiat Prax 2006; 33:34-41