Umdenken: Mediziner fordern adäquaten Umgang mit Corona
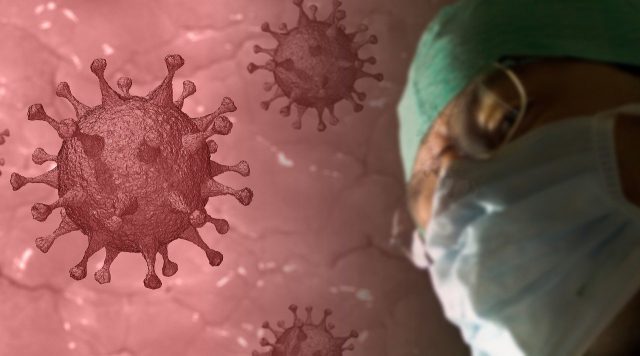 (c) pixabay
(c) pixabay Experten aus Wien und Innsbruck plädierten zu Wochenbeginn im Umgang mit der Corona-Pandemie zu mehr Verhältnismäßigkeit. Sie wünschen sich mehr Normalität.
Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin, Günter Weiss, plädiert für mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Coronavirus, warnt vor Alarmismus und mahnt Verhältnismäßigkeit ein. Es gelte nun, mehr Normalität zu wagen und von „überschießenden Ängsten“ wegzukommen, sagte Weiss im APA-Gespräch und sprach sich gleichzeitig für ein Aus der derzeitigen Teststrategie mit zu vielen Tests und einem Hin zu einer „symptombasierten Diagnostik“ aus. Nicht alarmierend stellt sich für den renommierten Mediziner, der dem Beraterstab der Coronavirus-Taskforce im Gesundheitsministerium angehört, derzeit auch die Situation in den Krankenhäusern dar: „Wir sind noch weit entfernt von einer drohenden Überlastung. Es ist wichtig, dass man das Augenmaß behält. Corona-Patienten machen einen nur ganz geringen Prozentsatz unserer Patienten aus.“
Es gehe darum, auch alle anderen Patienten gut zu behandeln, „damit sie die Therapie bekommen, die sie brauchen“, stimmte Weiss mit jüngsten Aussagen des Grazer Allgemeinmediziners und Public Health-Experten Martin Sprenger überein, wonach man das Virus zwar ernst nehmen, aber „den Scheinwerfer wegnehmen und alle Krankheiten wieder gleich beleuchten“ solle. Auch im Hinblick auf die kommende kalte Jahreszeit plädierte Weiss für Rationalität. „Nicht jeder normale Schnupfen sollte sofort einen Alarm auslösen“, betonte er. Wichtig sei daher, die Diagnostik wieder in die Hand der Mediziner zu geben und „endlich wieder zurückzugehen zu den normalen Prinzipien der Medizin“. Dies bedeute, Symptome gehörten bereits – wie bei allen anderen Krankheiten – im niederschwelligen, niedergelassenen Bereich abgeklärt. Das Setzen von diagnostischen Schritten sei eine ärztliche Aufgabe.
Österreich müsse lernen, mit einem bleibenden Corona-Risiko zu leben. Drastische Maßnahmen sind bei weitem nicht immer verhältnismäßig, aufgestaute Reformen im Gesundheitswesen notwendig, erklärten auch Experten der Ludwig Boltzmann Gesellschaft und der Plattform Patientensicherheit bei einem Hintergrundgespräch in Wien. „Wir haben gelernt, dass Hydroxychloroquin nicht wirkt. Wir haben gelernt, dass Cortison wirkt. Wir haben gelernt, dass eine Antikoagulation bei COVID-19-Patienten wirkt. Viel mehr haben wir nicht gelernt. Ich glaube wir sollten uns vor Augen halten, dass wir dieses Virus nicht mehr ausrotten können werden. Wir werden irgendwie lernen müssen, damit umzugehen“, sagte Harald Willschke, Leiter des Ludwig Boltzmann Instituts für digitale Gesundheit und Patientensicherheit in Wien, vom Beruf Anästhesist und Intensivmediziner am Wiener AKH. Er fürchtet allerdings doch Kapazitätsprobleme in Spitälern. „Der Föderalismus gehört abgeschafft“, fordert er deshalb. Eine Pandemie-Krise könne man nur nach dem Top-Down-Prinzip managen.
Vor Langzeitschäden und der Gefährdung der Sicherheit aller Patienten durch überzogene Lockdown-Maßnahmen im Gesundheitswesen warnte Andreas Sönnichsen, Leiter der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin der Meduni Wien. Die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen sei zum Teil vorübergehend um 90 Prozent zurückgegangen. Es hätte um bis zu 40 Prozent weniger Hospitalisierungen wegen Herzinfarkten und minus 20 Prozent bei den Spitalsaufnahmen wegen Schlaganfällen gegeben. „Geplante Krebs-Chemotherapien haben nicht stattgefunden“, kritisierte Sönnichsen. Er ortet auch neue Entwicklungen im Vergleich zur ersten Welle: „In der ersten Welle hatten wir bei 16.000 bestätigten Fällen rund 700 Todesfälle. Jetzt hatten wir bei 27.000 weiteren bestätigten Fällen rund hundert Todesfälle. Die Infection Fatality Rate ist von anfänglich vier Prozent auf 0,4 Prozent zurückgegangen.“ Mit neun Todesfällen pro 100.000 Einwohner durch COVID-19 sei die Mortalitätslast ähnlich hoch wie durch Verkehrsunfälle in Österreich. (red/APA)




















































































