Wiener Mediziner erforschen aggressive Hirntumore
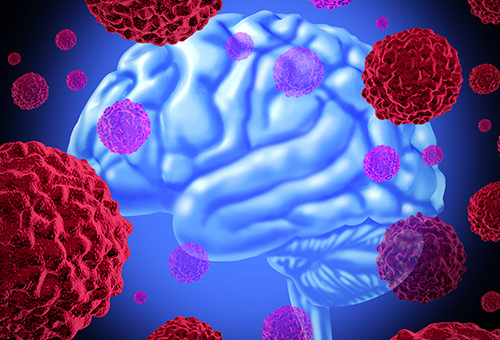
Eine Studie mit maßgeblicher Beteiligung der Meduni Wien liefert neue Erkenntnisse zur Entstehung bestimmter Hirntumoren. Das könnte effektivere Therapie ermöglichen. Die Studie wurde im Top-Journal „Cancer Cell“ publiziert.
Ein internationales Studienteam unter maßgeblicher Beteiligung von Forschern des Comprehensive Cancer Center (CCC) der Meduni Wien und des AKH Wien zeigt zum ersten Mal weltweit die molekularen Unterschiede einzelner Tumorzellen in Ependymomen, einer aggressiven Hirntumorform. Die Forscher belegen weiters, dass Ependymome in einer bestimmten Stammzellnische des Gehirns entstehen. Auf Basis dieser Erkenntnisse konnten sie klären, warum sich manche Ependymome sehr aggressiv verhalten und schlecht zu behandeln sind, andere dagegen eine bessere Prognose aufweisen. Die Therapieansätze, die von den Ergebnissen abgeleitet wurden, sind in ersten Labortests vielversprechend, teilt die Meduni mit. Die Arbeit wurde im Top-Journal „Cancer Cell“ publiziert.
Ependymome sind seltene Hirntumoren, die bei Kindern und bei Erwachsenen auftreten können. Zudem handelt es sich um eine heterogene Tumorgruppe und es war lange nicht bekannt, warum manche eine gute Prognose und manche einen sehr aggressiven Verlauf aufweisen, und weiters warum die Ependymome von Kindern besonders häufig mit einer schlechten Prognose verbunden sind. Die nun publizierte Studie nutzte modernste Methoden wie das Single Cell Sequencing, um einzelne Tumorzellen genomweit zu analysieren und ihre molekularbiologischen Eigenschaften zu beschreiben. Eine wesentliche Erkenntnis besteht im Nachweis, dass Ependymomzellen aus einer bestimmten Stammzellnische des Gehirns entstehen. Damit weisen sie auch oft Eigenschaften von Stammzellen auf. Stammzellen besitzen die Fähigkeit, andere Körperzellen zu ersetzen und zu Körperzellen mit verschiedenen Funktionen heranzureifen. Sind die Zellen entartet, entsteht eine besonders aggressive Form von Krebs.
Die Studie ist ein Kooperationsprojekt der Meduni Wien, dem Dana-Farber Cancer Institute und der Harvard Medical School sowie dem Broad Institute of MIT in Boston, dem Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Hopp Kindertumorzentrum in Heidelberg. (red)
Zur Studie: https://doi.org/10.1016/j.ccell.2020.06.004




















































































